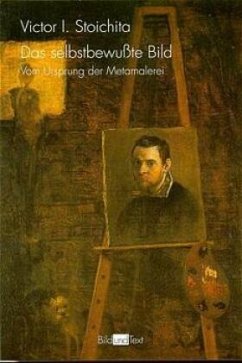Produktdetails
- Bild und Text
- Verlag: Brill Fink / Brill Fink
- Artikelnr. des Verlages: 1882964
- 1998.
- Seitenzahl: 381
- Deutsch
- Abmessung: 240mm x 170mm
- Gewicht: 1086g
- ISBN-13: 9783770532063
- ISBN-10: 3770532066
- Artikelnr.: 06852950
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Der Code ist geknackt, das kann keiner nachmachen: Viktor I. Stoichita hört zu, wie die Bilder sich selbst erklären
Eine der Künstleranekdoten von Plinius dem Älteren handelt von der ersten Begegnung zwischen den Malern Protogenes und Apelles. Apelles war eigens nach Kos gereist, um endlich dem Mann zu begegnen, dessen Kunst höchsten Ruhm im antiken Griechenland besaß. Nach seiner Landung begab er sich sofort in dessen Atelier und begann dort, trotz Abwesenheit des Meisters, einen Dialog mit Protogenes, der nicht in Worten, sondern kongenial mit Linien auf der Leinwand geführt wurde. Als Protogenes nach Hause kam, bemerkte er die "Visitenkarte" seines Verehrers in Form einer vollendeten Linie, die dieser auf der Staffelei hinterlassen hatte. Der gemalte Dialog, der nichts als die Malerei selbst zum Thema hatte, lief schließlich auf einen Wettstreit der beiden Maler hinaus, die sich gegenseitig mit immer feineren Linien beeindruckten. Apelles gewann, da er eine Linie auf die Leinwand setzte, die dem Rivalen keinen Platz mehr für eine Replik ließ.
Die Erzählung ist deshalb so interessant, weil sie den Malern eine eigene Sprache zubilligt. Die Linien, die Farben und die Formen sind es, die ein eigenes Zeichensystem, eine eigene Syntax und Semantik bilden, welche die Maler in ihren Bildern immer wieder neu erfinden. Die beiden antiken Künstler kommunizieren in der Sprache der Malerei, in der sich vermutlich alle Maler miteinander verständigen, in der ferner die wesentlichen Aussagen über Malerei getroffen werden und sich das Bild auch direkt zum Betrachter über sich selbst äußert.
Erst die sich selbst thematisierende Malerei (Metamalerei), die Gegenstand der systematischen Studie von Victor Stoichita ist, liefert die eigentliche oder adäquate Bildtheorie. Das prominente, überwiegend aus den Niederlanden und Spanien stammende Bildmaterial umspannt Gemälde und Diskurse über Malerei vom reformatorischen Ikonoklasmus bis hin zum "Umgedrehten Gemälde" von Cornelis Gijsbrecht (1675) als einem Kulminationspunkt in der Geschichte der Metamalerei. Es gibt auch eine spätmittelalterliche Vorgeschichte des selbstreflexiven Bildes, doch der eigentliche Diskurs über Malerei, so lautet Stoichitas These, konnte sich erst entfalten, als das gemalte Bild von seinen religiösen Funktionen befreit war. Der Weg, den die Malerei beschreitet, um zu sich selbst zu gelangen, ist beileibe kein Triumphzug. Er führt über weitverzweigte Pfade und Umwege, für deren Erkundung der Autor ein scharfsinniges heuristisches Verfahren entwirft.
Mit dem Thema der Metamalerei bezieht sich Stoichita auf eine ursprünglich aus der Logik stammende, dann in der Semiotik und Linguistik weiterentwickelte Fragestellung, die der französische Poststrukturalismus in die Literaturwissenschaft eingeführt hat. Dort wurde nach der wechselseitigen Beziehung von Texten (Intertextualität) und nach deren Selbstbezüglichkeit (Metatextualität) gefragt. Zu den vielfältigen Funktionen der Metatextualität, die Stoichita aufgreift, gehört in der Metamalerei etwa das Vorzeigen von Künstlichkeit des Gemäldes im Sinne von Gemachtsein und Erfundensein.
Es geht ferner um die Schaffung von Reflexionsräumen über Malerei und das Tableau, die Selbstinszenierung des Autors, die Selbstbestätigung des Mediums oder aber dessen Parodie. Leider macht Stoichita dem Leser die theoretische Basis, auf die er sich stützt, nicht sichtbar; er führt Begriffe und Denkfiguren der Selbstreferentialität meist unkommentiert ein. Eine dreiseitige Einleitung ist einfach zu kurz für das anspruchsvolle theoretische Programm. Gleichwohl handelt es sich bei dem Buch um eine der intelligentesten Antworten auf die notorisch gestellte Frage: Was ist ein Bild? Der Autor hat nämlich eine Fragestellung entwickelt, welche die Bilder selbst darauf antworten läßt.
Das Buch gliedert sich in drei Teile, das "überraschte", das "neugierige" und das "methodische Auge", die als Epochenembleme der metapikturalen Thematik fungieren. Es beginnt im Kapitel "Wandöffnungen" mit Pieter Aertsens Küchenstilleben "Christus bei Maria und Martha" (1552), das der Kunstwissenschaft schon immer Kopfzerbrechen bereitet hat: Das Gemälde ist kein Stilleben, da die Gattung noch gar nicht erfunden war, und auch kein echtes Historiengemälde, weil es die religiöse Szene marginalisiert. Stoichitas Analyse der paradoxen Bildstruktur konzentriert sich zunächst auf die Inszenierung der Gegenstände im Stilleben, welche teils als perfekte Trompe-l'oeils einen raffinierten Illusionismus vorführen, diesen aber mit gleicher Konsequenz durchbrechen, indem die Regeln des Trompe-l'oeils völlig mißachtet werden. Die Malerei vollführt eine ironische Selbstinszenierung, welche die Grenze von Wirklichkeit und Schein im Gemälde aufzeigen. Auch die Hintergrundszene läßt zunächst nicht erkennen, ob sie ein Gemälde im Gemälde ist oder, wie sich dann herausstellt, eine Wandöffnung, die den Blick in einen weiteren Raum führt.
Aber das Gemälde liefert immer wieder versteckte Hinweise, wie es richtig betrachtet werden will. Eine Kachel mit der Inschrift "Luc X" ist genau an der Gelenkstelle der ineinandergreifenden Räume plaziert und deutet an, daß es sich nicht um eine gewöhnliche Küchenszene handelt, sondern um die Geschichte "Christus bei Maria und Martha" aus dem Lukasevangelium. Stoichitas Bildanalyse zeigt, wie sich die Bildelemente zu einer systematischen Bildsyntax anordnen, die das Gemälde lesbar macht. Erst dann beginnt die Interpretation, welche den ursprünglichen Ort des Bildes - Aertsens Gemälde waren in Küchen aufgehängt - zum Ausgang nimmt. Die Elemente des Stillebens, Lammkeule, Nelke und Sauerteig, bilden als "intertextuelle Schwelle" den Übergang zur religiösen Szene, von der irdischen zur spirituellen Nahrung, und formen "den symbolischen Text", der sich auf das Mysterium der Inkarnation und die Theologie von Wort und Fleisch bezieht. Stoichitas Verfahren erteilt der herkömmlichen Ikonographie eine Absage, da es das Bild als Text definiert. Jede ikonographische Analyse, die Bilder und literarische Quellen willkürlich aufeinander bezieht, greift somit zu kurz, da erst die Textualität des Bildes den Bildprozeß als Methode der Enkodierung und Dekodierung von Bedeutung erkennen läßt.
Im zentralen Kapitel des Buches untersucht Stoichita die "intertextuelle Verzahnung" der Gemäldesammlungen in den sogenannten Liebhaber-Kabinetten des siebzehnten Jahrhunderts. Hier münden die bisherigen Ergebnisse der strukturalistischen Bildanalysen in einen Diskurs des Gemäldes über Gemälde im Gemälde. Im "Liebhaber-Kabinett des Cornelis van der Geest" entwirrt der Autor sukzessive das feingesponnene Bedeutungsnetz der wie zufällig arrangierten, in auffälliger Unübersichtlichkeit dargebotenen Vielzahl von Personen und Kunstgegenständen. Stoichita macht deutlich, wie das "neugierige Auge", von dem Justus Lipsius sprach, hier die überbordenden Schönheiten der Welt-, Wissens- und Gedächtnissysteme bis zum Überdruß beschwört, und benennt Descartes als Kronzeugen, der die "Kultur der Gelehrsamkeit", welche die Liebhaber-Kabinette repräsentieren, verwarf. In einem Akt der Reinigung befreite Descartes seine Studierstube von allen Büchern und sich selbst von fremden Gedanken: "Wer viele Gegenstände auf einmal betrachten will, sieht keinen von ihnen deutlich." Der Satz aus dem "Discours" liest sich wie ein Abgesang auf die mit Dingen überfrachteten Sammlungen.
Die cartesianische Theorie des Sehens leitet im dritten Teil des Buches den Paradigmenwechsel von der "Kultur der Neugier" hin zu einer aller Begriffe ledigen "Kultur der Methode" ein, welche die Tabula rasa und die weiße Leinwand als Signum wählt. Spätestens hier zeigt sich, daß die Frage nach der metapikturalen Funktion der Bilder auch zur Beschreibung historischer Verläufe taugt. Das methodische Sehen siedelt Stoichita in der holländischen Malerei eines Vermeer oder Pieter de Hooch an. Die Holländer konzentrieren ihren Blick auf einzelne Dinge, sie thematisieren den "Akt der pikturalen Perzeption als selbstreflexive Wahrnehmung" und stellen grundsätzlich die Frage, was Malerei sei. Gemälde, Karten und Spiegel bilden als "metafiktionale Darstellungen" den Ausgangspunkt der Untersuchung. In Vermeers "Frau mit Waage" stellt Stoichita anhand der semantischen Verknüpfung von wägender Frau mit dem Gemälde des Jüngsten Gerichts erneut die Gretchenfrage, an der sich die Ikonographie-Kritik der achtziger Jahre, ausgehend von Panofskys Theorem des "disguised symbolism", entzweit hat: Ist die Annahme von Mehrdeutigkeit ein Mißstand der Kunstwissenschaft, oder hat die vage Bildaussage Methode? Stoichita verteidigt die Uneindeutigkeit und führt aus, daß dem Emblem bei der Konstruktion von Sinn eine Schlüsselrolle zukommt. Es fällt jedoch schwer, der äußerst komprimierten Argumentation zu folgen. Der Autor verschweigt uns, inwiefern das Emblem ein "polysemisches Zeichen" ist und wie Vermeers Gemälde mit dem Emblem, das in der Bild-Text-Kombination eine historisch genau definierte Gattung ist, zur Deckung kommt. Ein Blick in die neuere Forschung zur Emblematik hätte hier vermutlich Klarheit geschaffen.
Das letzte große Kapitel des Buches rückt die verschiedenen Modalitäten des Selbstporträts und der Inszenierung des Malakts ins Zentrum des metaartistischen Diskurses. Stoichitas an Foucault anschließende Überlegungen zu Velázquez' "Meninas" untersuchen, wie sich das Bild durch Grenzen (Leinwand, Spiegel, Tür, Gemälde) definiert, in deren Mitte der Malakt präsentiert wird. Der Spiegel reflektiert die Malerei, das Gemälde mit dem Königspaar auf der Staffelei, von der wir nur die Rückseite sehen. Gespiegelte Malerei, befand Federico Zuccari, dessen Kunsttheorie Velázquez bekannt war, ist die höchste, die geistige Form der Kunst. Ihre Antithese ist die materielle Substanz des Gemäldes, die nackte Leinwand, welche die zeitgenössische spanische Poesie als Asche, als Grab des Bildes bezeichnete. Schritt für Schritt legt Stoichita das Thema des Gemäldes offen, die unendliche Struktur der Repräsentation, die auf nichts außer sich selbst verweist.
Das Buch endet mit Gijsbrechts "umgedrehtem Gemälde", der Antithese des Gemäldes schlechthin. Hier endlich kommt Stoichita auf die impliziten Paradoxien eines jeden selbstreflexiven Diskurses zu sprechen. Gijsbrechts Tableaus stellen die Technik der Paradoxie dar. Sie geben vor, bloße Keilrahmen, bloße Farbe zu sein und zeigen mit den Mitteln der Malerei, daß dies alles Lüge ist. Die Kreisfigur der Selbstreferentialität ist perfekt, wie es unmöglich ist, ihr zu entkommen.
Erwähnt werden müssen die mangelhafte Ausstattung des Buches, die klägliche Qualität der Abbildungen, die konfuse Bild-Text-Koordination und das Fehlen eines Index. In methodologischer Hinsicht aber ist es einer der wichtigsten Beiträge zur Logik des neuzeitlichen Bildes. Im interdisziplinären Bilddiskurs wird es mit Sicherheit seine Anhänger finden, und man kann nur hoffen, daß es auch innerhalb der sich gern allzu konservativ gebenden Kunstwissenschaft auf breite Resonanz treffen wird.
CHRISTIANE KRUSE
Victor I. Stoichita: "Das selbstbewußte Bild". Der Ursprung der Metamalerei. Wilhelm Fink Verlag, München 1998. 381 S., Abb, br. 78,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main