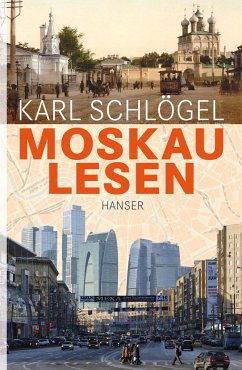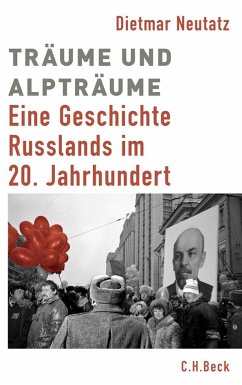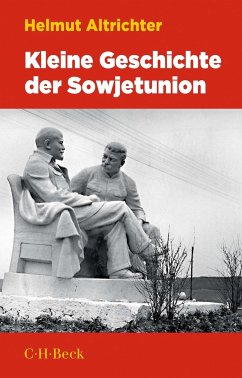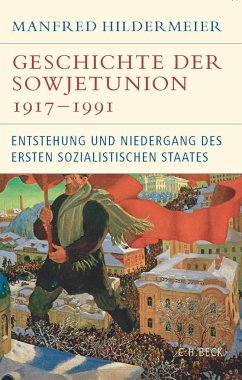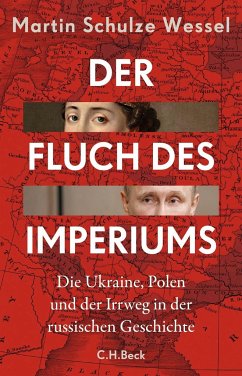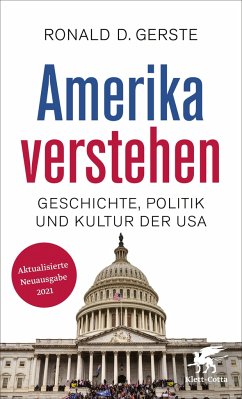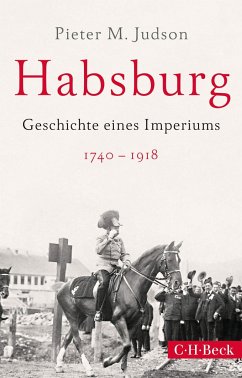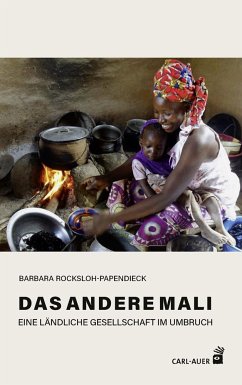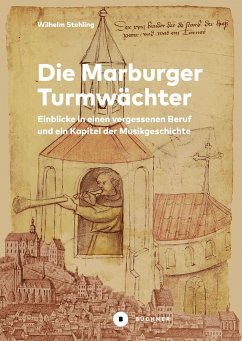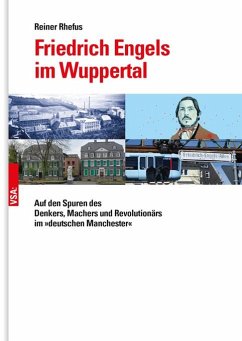Nicht lieferbar

Das sowjetische Jahrhundert
Archäologie einer untergegangenen Welt
"SCHLÖGEL ERSPÜRT, ERTASTET DIMENSIONEN, DIE ANDERE HISTORIKER GAR NICHT WAHRNEHMEN." WELT AM SONNTAGDer große Osteuropa-Historiker Karl Schlögel erzählt von der untergegangenen sowjetischen Welt in ihrem Jahrhundert. Er ist dabei, wenn die Megabauten des Kommunismus eingeweiht und die Massengräber des stalinschen Terrors freigelegt werden. Er erkundet die Weite des Eisenbahnlandes und die Enge der Gemeinschaftswohnung. Seine Archäologie legt Überlebensorte im Alltag frei ? die Moskauer Küche oder die Warteschlange. Die Orte des Glücks und der kleinen Freiheit fehlen nicht. So entste...
"SCHLÖGEL ERSPÜRT, ERTASTET DIMENSIONEN, DIE ANDERE HISTORIKER GAR NICHT WAHRNEHMEN." WELT AM SONNTAG
Der große Osteuropa-Historiker Karl Schlögel erzählt von der untergegangenen sowjetischen Welt in ihrem Jahrhundert. Er ist dabei, wenn die Megabauten des Kommunismus eingeweiht und die Massengräber des stalinschen Terrors freigelegt werden. Er erkundet die Weite des Eisenbahnlandes und die Enge der Gemeinschaftswohnung. Seine Archäologie legt Überlebensorte im Alltag frei ? die Moskauer Küche oder die Warteschlange. Die Orte des Glücks und der kleinen Freiheit fehlen nicht. So entsteht das Panorama einer Zivilisation, die mehr war als das politische System und ohne die «die Zeit danach», in der wir heute leben, nicht zu verstehen ist.
Der große Osteuropa-Historiker Karl Schlögel lädt mit seiner Archäologie des Kommunismus zu einer Neuvermessung der sowjetischen Welt ein. Wir wussten immer schon viel darüber, wie "das System" funktioniert, weit weniger über die Routinen des Lebens in außergewöhnlichen Zeiten. Aber jedes Imperium hat seinen Sound, seinen Duft, seinen Rhythmus, der auch dann noch fortlebt, wenn das Reich aufgehört hat zu existieren. Karl Schlögel sondiert das Terrain, die historischen Schichten in einem von Krieg, Revolution und Bürgerkrieg gezeichneten Land. Er lässt noch einmal die frühe sowjetische Moderne Revue passieren, die Schlachtfelder der Arbeit und der Verbrannten Erde. Er interessiert sich für Paraden der Macht ebenso sehr wie für die Rituale des Alltags, er erkundet die Weite des Eisenbahnlandes und die Enge der Gemeinschaftswohnung, in der Generationen von Sowjetmenschen ihr Leben zubrachten. Seine Archäologie legt soziale Orte frei, die einmal Überlebensorte im Alltag gewesen sind ? die Moskauer Küche oder die Warteschlange mit der in ihr verausgabten Lebenszeit, der Kulturpark, die Datscha, die Ferien an der Roten Riviera. In allem ? ob im Mobiliar, im Duft des Parfums, im Verstummen des Glockenklangs oder in der Stimme des Radiosprechers ? hat das "Zeitalter der Extreme" seine Spur hinterlassen.
Der große Osteuropa-Historiker Karl Schlögel erzählt von der untergegangenen sowjetischen Welt in ihrem Jahrhundert. Er ist dabei, wenn die Megabauten des Kommunismus eingeweiht und die Massengräber des stalinschen Terrors freigelegt werden. Er erkundet die Weite des Eisenbahnlandes und die Enge der Gemeinschaftswohnung. Seine Archäologie legt Überlebensorte im Alltag frei ? die Moskauer Küche oder die Warteschlange. Die Orte des Glücks und der kleinen Freiheit fehlen nicht. So entsteht das Panorama einer Zivilisation, die mehr war als das politische System und ohne die «die Zeit danach», in der wir heute leben, nicht zu verstehen ist.
Der große Osteuropa-Historiker Karl Schlögel lädt mit seiner Archäologie des Kommunismus zu einer Neuvermessung der sowjetischen Welt ein. Wir wussten immer schon viel darüber, wie "das System" funktioniert, weit weniger über die Routinen des Lebens in außergewöhnlichen Zeiten. Aber jedes Imperium hat seinen Sound, seinen Duft, seinen Rhythmus, der auch dann noch fortlebt, wenn das Reich aufgehört hat zu existieren. Karl Schlögel sondiert das Terrain, die historischen Schichten in einem von Krieg, Revolution und Bürgerkrieg gezeichneten Land. Er lässt noch einmal die frühe sowjetische Moderne Revue passieren, die Schlachtfelder der Arbeit und der Verbrannten Erde. Er interessiert sich für Paraden der Macht ebenso sehr wie für die Rituale des Alltags, er erkundet die Weite des Eisenbahnlandes und die Enge der Gemeinschaftswohnung, in der Generationen von Sowjetmenschen ihr Leben zubrachten. Seine Archäologie legt soziale Orte frei, die einmal Überlebensorte im Alltag gewesen sind ? die Moskauer Küche oder die Warteschlange mit der in ihr verausgabten Lebenszeit, der Kulturpark, die Datscha, die Ferien an der Roten Riviera. In allem ? ob im Mobiliar, im Duft des Parfums, im Verstummen des Glockenklangs oder in der Stimme des Radiosprechers ? hat das "Zeitalter der Extreme" seine Spur hinterlassen.