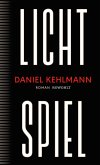Martin, sechsundsiebzig, wird von einer ärztlichen Diagnose erschreckt: Ihm bleiben nur noch wenige Monate. Sein Leben und seine Liebe gehören seiner jungen Frau und seinem sechsjährigen Sohn. Was kann er noch für sie tun? Was kann er ihnen geben, was ihnen hinterlassen? Martin möchte alles richtig machen. Doch auch für das späte Leben gilt: Es steckt voller Überraschungen und Herausforderungen, denen er sich stellen muss.
»Bernhard Schlink gehört zu den größten Begabungen der deutschen Gegenwartsliteratur. Er ist ein einfühlsamer, scharf beobachtender und überaus intelligenter Erzähler. Seine Prosa ist klar, präzise und von schöner Eleganz.«
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
"Trost und Einsicht" spendet Bernhard Schlinks neuer Roman Rezensent Marc Reichwein. In Schlinks Geschichte über den unheilbar kranken Martin verbinden sich "Moralphilosophie" und "Existenzfragen", so Reichwein, mit den Mitteln der Unterhaltungsliteratur, also einer einfachen und zugänglichen Sprache (wie es Schlinks Credo ist). Martin muss nun entscheiden, was er mit den ihm verbliebenen Wochen anfangen will, er entschließt, seinem kleinen Sohn einen Brief zu hinterlassen. Dieser behandelt die großen Themen Liebe, Glaube, Herkunft und soll seinem Kind eine Lebenshilfe sein - dient dem Protagonisten aber auch als Mittel zur Selbstreflexion. Ein paar nicht ganz so originelle Nebenfiguren kann der Rezensent verzeihen, denn die Manier, mit der Schlink hier über den Tod reflektivert, überzeugt ihn auf alle Fälle.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH