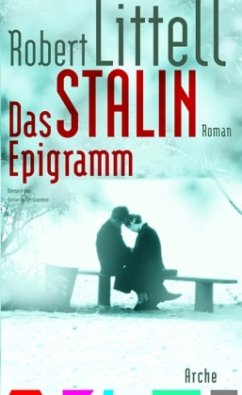1934 greift in Moskau ein verzweifelter Dichter zu seiner letzten Waffe: dem Wort
Dieses Buch ist ein Ereignis: Robert Littell, berühmt für seine Spionage- und Agententhriller, hat eine ungeheuerliche Geschichte niedergeschrieben, die auf einer persönlichen Begegnung beruht und ihn seit 30 Jahren verfolgt. Das Ergebnis ist ein atemberaubender Roman, der von einem verzweifelten Ringen erzählt, vom unerschütterlichen Glauben an die Macht des Wortes, von bedingungsloser Liebe, von Hoffnung und Verrat.
Moskau 1934: Stalins eiserne Hand hält ein ganzes Land im Würgegriff. Der Herrscher im Kreml treibt unbarmherzig die Kollektivierung voran, in deren Zuge Millionen von Bauern verhungern, während seine Schergen die Städte durchkämmen und willkürlich Regimegegner verhaften.
Ossip Mandelstam, einst ein berühmter und angesehner Dichter, ist in Ungnade gefallen und tritt in Moskau in Kaschemmen vor einer Handvoll Gästen auf, um dort seine Gedichte vorzutragen. Bei einem dieser Auftritte begegnen er und seine Frau Nadeschda der jungen, betörend schönen Theaterschauspielerin Zinaida. Es beginnt eine flammende Ménage-à-trois, die der Dichter und die beiden Frauen hinter geschlossenen Vorhängen und verriegelten Türen leben. Bis Ossip Mandelstam eines Abends Nadeschda und Zinaida zu sich ruft, um ihnen ein Gedicht vorzutragen, mit dem er das Volk aufrütteln will: Das Stalin-Epigramm. 16 Verse, von denen jeder einzelne den Tod bedeuten kann.
Dieses Buch ist ein Ereignis: Robert Littell, berühmt für seine Spionage- und Agententhriller, hat eine ungeheuerliche Geschichte niedergeschrieben, die auf einer persönlichen Begegnung beruht und ihn seit 30 Jahren verfolgt. Das Ergebnis ist ein atemberaubender Roman, der von einem verzweifelten Ringen erzählt, vom unerschütterlichen Glauben an die Macht des Wortes, von bedingungsloser Liebe, von Hoffnung und Verrat.
Moskau 1934: Stalins eiserne Hand hält ein ganzes Land im Würgegriff. Der Herrscher im Kreml treibt unbarmherzig die Kollektivierung voran, in deren Zuge Millionen von Bauern verhungern, während seine Schergen die Städte durchkämmen und willkürlich Regimegegner verhaften.
Ossip Mandelstam, einst ein berühmter und angesehner Dichter, ist in Ungnade gefallen und tritt in Moskau in Kaschemmen vor einer Handvoll Gästen auf, um dort seine Gedichte vorzutragen. Bei einem dieser Auftritte begegnen er und seine Frau Nadeschda der jungen, betörend schönen Theaterschauspielerin Zinaida. Es beginnt eine flammende Ménage-à-trois, die der Dichter und die beiden Frauen hinter geschlossenen Vorhängen und verriegelten Türen leben. Bis Ossip Mandelstam eines Abends Nadeschda und Zinaida zu sich ruft, um ihnen ein Gedicht vorzutragen, mit dem er das Volk aufrütteln will: Das Stalin-Epigramm. 16 Verse, von denen jeder einzelne den Tod bedeuten kann.

Der Thrillerautor Robert Littell erteilt dem russischen Avantgardedichter Ossip Mandelstam, der vor siebzig Jahren im Gulag ums Leben kam, das Wort.
Angenommen, es wäre wahr: Ein Diktator weint, denn er hat ein Gedicht gelesen, das ihn tief bewegt. Es spricht von verhungernden Bauern und einem Georgier, dem das Töten dieser Bauern "wie Himbeeren" schmeckt. Der Diktator will den Dichter bestrafen, doch er kann seine Worte nicht ungeschehen machen. Er ein Bauernschlächter? Der Diktator grübelt, seine Autorität wankt, und deshalb wankt bald seine mörderische Entourage. Die Barbarei, das ist die Moral der Geschichte, demontiert sich selbst und landet auf dem "Müllhaufen der Geschichte". Die Kultur aber setzt sich schweigend auf den Thron der Zivilisation.
Immer wieder haben Menschen auf diese Weise an die Kraft der Worte geglaubt. Sie haben sich ihnen existentiell verschrieben wie der russische Avantgardedichter Ossip Mandelstam, dessen Benennungsextremismus ihn direkt in Stalins Visier und von dort in den todbringenden Gulag führte: das Schicksal eines Wortmenschen, der aufschrieb, was er sah, und nicht das, was er sehen sollte. Robert Littell, Autor von fünfzehn Spionageromanen, Kalte-Kriegs-Reportagen und politischen Interviews, hat Mandelstam jetzt, mehr als siebzig Jahre nach dessen Deportation, das Wort erteilt.
Mit dem Entzug von Worten hatte alles begonnen. Viele halten Mandelstam, der damals in Moskau ein Bohemienleben führte, noch heute für eine der bedeutendsten lyrischen Stimmen seiner Generation. Mandelstam, erfolgsverwöhnt, eitel und poetoerotisch, liebte es, vor Freunden zu lesen. Littell lässt ihn als Homo poeticus auftreten - Mitte der dreißiger Jahre allerdings nur noch vor elf Zuhörern. "Ich dachte, Madelstam wäre tot", sagt eine Passantin zu Beginn des Buchs. "Tot, aber noch nicht begraben", erwidert der Dichter, dessen größtes Vergehen nicht in besagtem Stalin-Epigramm "Wir Lebenden spüren den Boden nicht mehr" gelegen hat, für das Mandelstam 1934 in die Verbannung geschickt wurde, sondern in seiner Verweigerung jeder weiteren Anteilnahme am Schicksal des großen Generalsekretärs - zumindest in der Version Robert Littells.
Wahr ist: Künstlerkollegen wie Pasternak und Schostakowitsch haben Stalin ganze Werke gewidmet, während Mandelstam es vorzog, ihn als wurstfingrigen "Gebirgler" zu verspotten. Wahr ist allerdings auch, dass Mandelstam, nachdem er 1937 aus der Verbannung zurückgekehrt war, seinen Ruf mit einer Stalin-Ode zu rehabilitieren versuchte. Über deren literaturgeschichtlichen Stellenwert streiten sich Philologen und Biographen bis heute. Es scheint nicht ausgemacht, dass das Mandelstam-Bild, das seine Witwe Nadeschda Jakowlewna in ihren Memoiren gezeichnet hat, nämlich das eines Märtyrers, der für seine Überzeugungen zu sterben bereit war, die Sache angemessen trifft. Immerhin lässt Littell ihn sagen: "Ich tauge nicht für den politischen Kampf... Ich neige zur Geste." Es ist mit guten Gründen anzunehmen, dass Mandelstam eher die verordnete Bedeutungslosigkeit seiner Werke als das Schicksal der zwangskollektivierten Bauern zu schaffen machte. Doch diesen Umstand konnte Littell bei seiner Recherche nach eigenem Gusto gewichten.
Er ist als Thrillerautor eine Spannungsquelle für Millionen von Lesern und versteht es, Stoffe so zu dramatisieren, dass sie den Massengeschmack nicht überfordern. So geschieht es, dass trotz der historischen Vorlage, trotz der real existierenden Verbrechen, die im Namen der Revolution begangen wurden und die hier durchaus bewegend geschildert sind, eine Verkitschung der Mandelstam-Story nicht ausbleibt. Littell dichtet dem Helden eine Dreiecksbeziehung an. Später ist von Musen und Erektionsstörungen die Rede, und Künstlerpathos ist das Schmiermittel zwischen den Kapiteln. All dies soll erwähnt sein, weil es der Vorlage viel von ihrer existentiellen Ambivalenz nimmt. Littell macht aus dem Fall Mandelstam ein Fanal. Hier zeigt sich der Wahnsinn stalinistischer Willkür und Paranoia. In fiktiven Sequenzen lässt er Generalsekretär und Dichter aufeinandertreffen. Stalin will ein Gedicht, bekommt es erst nicht, dann doch in Form einer Ode, wittert darin aber wieder nur Spott, was zu Mandelstams zweiter Verhaftung führt. 1938 stirbt der Künstler an Hunger, Typhus oder Herzversagen in einem Gulag bei Wladiwostok. Sein Werk überlebte, weil seine Frau Nadeschda alles auswendig lernte.
Vielleicht ist es Zufall, dass Robert Littell, dessen Sohn Jonathan vor zwei Jahren mit einem hochumstrittenen Naziroman schlagartig Berühmtheit erlangte, nun ausgerechnet über Stalin schreibt. Vielleicht ist es aber auch eine Frage der Kontinuität. Littell der Ältere ist spezialisiert auf Agententhriller, die im Kalten Krieg spielen. Am besten funktioniert "Das Stalin-Epigramm" deshalb immer dann, wenn es geheimdienstlich wird. Die Ab- und Verhörszenen gehören zum Packendsten, was seit Solschenizyn über den sowjetischen Justiz- und Lageralltag geschrieben wurde - von zermürbenden Befragungen bis hin zu Scheinhinrichtungen, wie auch Ossip Mandelstam sie 1934 erfahren haben mag.
Mit der "Explosionskraft" eines Gedichts war der Dichter damals angetreten, jenes Regime in die Knie zu zwingen, das ihm mit der sozialistisch-realistischen Doktrin die Existenzberechtigung als Künstler entzog. Am Ende wird er selbst bezwungen. Er flieht in die Zitadelle seiner Gedichte. Bald folgt die physische Kapitulation: Tod durch Erschöpfung, Typhus oder Herzversagen. Das ist die bittere Essenz dieser wahren Geschichte. Aber Littell will sie dem Leser in ihrer Illusionslosigkeit nicht zumuten. So lässt er Stalin im letzten Absatz mehrfach gegen eine Panzerglasscheibe schlagen und rufen: "Dieser Scheißkerl! Was soll ich jetzt machen?" Ob Stalin nun tatsächlich eine Obsession mit dem Dichter Mandelstam hatte und nicht darüber hinwegkam, ausgerechnet von ihm verschmäht zu werden, sein fiktiver Kunstverstand wirkt am Ende nicht nur furchtbar obszön, sondern auch literarisch pietätlos.
KATHARINA TEUTSCH
Robert Littell: "Das Stalin-Epigramm". Roman. Aus dem Amerikanischen von Werner Löcher-Lawrence. Arche Literatur Verlag, Zürich/Hamburg 2009. 397 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Folgerichtig sind es vor allem die geheimdienstlichen Szenen, die Katharina Teutsch bei der Lektüre fesseln. Schließlich ist Robert Littell als Autor von Agententhrillern bekannt geworden. Für Teutsch hat der Autor in diesen Momenten das Format eines Solschenizyn. Wenn Littell Ossip Mandelstam, neben Stalin die Hauptfigur im Buch, mitunter etwas kitschig als Homo poeticus mit Erektionsstörungen auftreten lässt, weniger als Märtyrer, verbucht Teutsch dies als Kollateralschaden der Literarisierung einer historischen Vorlage. Littells Versuch, die bittere Essenz der wahren Geschichte, Mandelstams Tod im Gulag, mit Stalins Obsession für den Dichter und sein Werk abzufedern, hält die Rezensentin allerdings für obszön und "literarisch pietätlos".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH