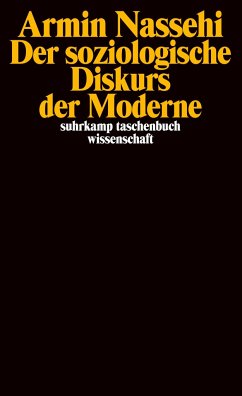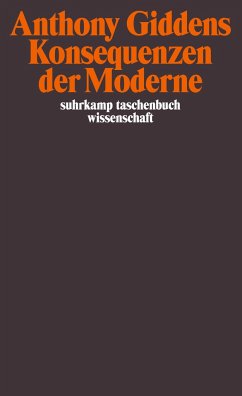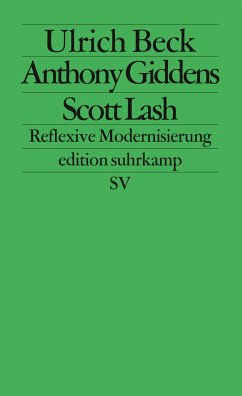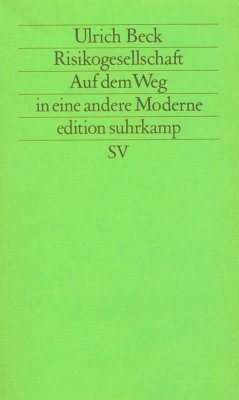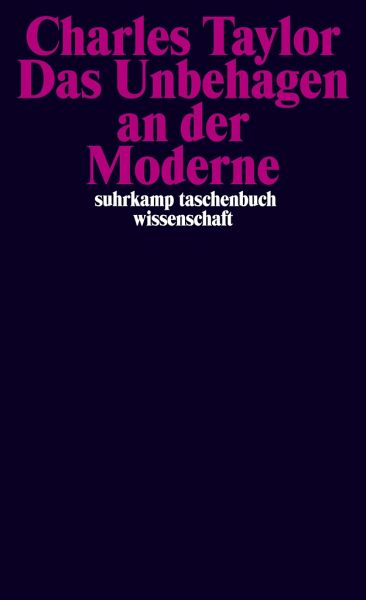
Das Unbehagen an der Moderne
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
15,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Was von den Verächtern der Gegenwartsgesellschaft als Dekadenz und Verfall begriffen wird, sehen die Verfechter dieser Gesellschaft als Fortschritt und Befreiung an. Beide Seiten sind nach Taylors Analyse im Irrtum.Ohne Schwächen und negative Seiten unserer realen Situation zu verkennen, zeigt er, daß das, was den Verächtern wie Verfall erscheint, in Wirklichkeit nur die Schattenseiten eines im Grunde positiven Ideals der Authentizität sind, das jedoch im Gegensatz zur Meinung der Verfechter des gesellschaftlichen Status quo bei weitem nicht erfüllt ist.Erst durch Einsicht in die wahren ...
Was von den Verächtern der Gegenwartsgesellschaft als Dekadenz und Verfall begriffen wird, sehen die Verfechter dieser Gesellschaft als Fortschritt und Befreiung an. Beide Seiten sind nach Taylors Analyse im Irrtum.
Ohne Schwächen und negative Seiten unserer realen Situation zu verkennen, zeigt er, daß das, was den Verächtern wie Verfall erscheint, in Wirklichkeit nur die Schattenseiten eines im Grunde positiven Ideals der Authentizität sind, das jedoch im Gegensatz zur Meinung der Verfechter des gesellschaftlichen Status quo bei weitem nicht erfüllt ist.
Erst durch Einsicht in die wahren historischen Quellen des Ideals der Authentizität und durch Besinnung auf die darin angelegten Möglichkeiten zur Stärkung sozialer wie individueller Anlagen kann es gelingen, die selbstzerstörerischen Tendenzen der gesellschaftlichen Fragmentierung züi überwinden.
Ohne Schwächen und negative Seiten unserer realen Situation zu verkennen, zeigt er, daß das, was den Verächtern wie Verfall erscheint, in Wirklichkeit nur die Schattenseiten eines im Grunde positiven Ideals der Authentizität sind, das jedoch im Gegensatz zur Meinung der Verfechter des gesellschaftlichen Status quo bei weitem nicht erfüllt ist.
Erst durch Einsicht in die wahren historischen Quellen des Ideals der Authentizität und durch Besinnung auf die darin angelegten Möglichkeiten zur Stärkung sozialer wie individueller Anlagen kann es gelingen, die selbstzerstörerischen Tendenzen der gesellschaftlichen Fragmentierung züi überwinden.