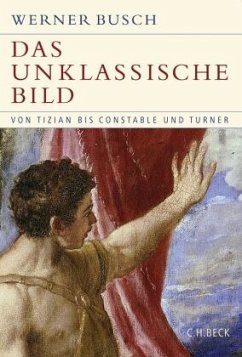Seit der Renaissance und bis ins 19. Jahrhundert beanspruchte das sogenannte klassische Bild seine Vorrangstellung. Es sollte Ideen zum Ausdruck bringen, die letztlich immateriell waren. Ebenfalls seit der Renaissance gab es jedoch eine zweite Tradition, die sich an der sinnlichen Erscheinung der Dinge orientierte. Werner Busch stellt diese Geschichte des unklassischen Bildes zum ersten Mal zusammenhängend dar.
Während beim klassischen Bild die Linie dominiert, ist das unklassische von der Farbe beherrscht. Sucht das klassische Bild seine Vollendung, so ist das unklassische prinzipiell unabschließbar. Erzählt das klassische Bild oft eine Geschichte, die von einem Text (etwa der Bibel) vorgegeben ist, so beruft sich das unklassische Bild auf die Natur und ihre Phänomene. Nachdem die Renaissance das klassische Bild definiert hatte, wurde es über Jahrhunderte von den mächtigen Akademien und unzähligen Traktaten gepredigt. Das unklassische Bild hingegen fand nie vergleichbare öffentliche Fürsprecher. Dabei hat es die abendländische Kunst seit Tizian begleitet, in Caravaggio und Rembrandt, in Constable und Turner prominente Protagonisten gefunden und in der Druckgraphik zu wichtigen Innovationen geführt. Mit seiner Gegengeschichte der neuzeitlichen Kunst macht Werner Busch sichtbar, welche Möglichkeiten eine Kunst abseits der offiziellen Doktrin hatte und wie sie die Kunst der Moderne vorbereitete.
Während beim klassischen Bild die Linie dominiert, ist das unklassische von der Farbe beherrscht. Sucht das klassische Bild seine Vollendung, so ist das unklassische prinzipiell unabschließbar. Erzählt das klassische Bild oft eine Geschichte, die von einem Text (etwa der Bibel) vorgegeben ist, so beruft sich das unklassische Bild auf die Natur und ihre Phänomene. Nachdem die Renaissance das klassische Bild definiert hatte, wurde es über Jahrhunderte von den mächtigen Akademien und unzähligen Traktaten gepredigt. Das unklassische Bild hingegen fand nie vergleichbare öffentliche Fürsprecher. Dabei hat es die abendländische Kunst seit Tizian begleitet, in Caravaggio und Rembrandt, in Constable und Turner prominente Protagonisten gefunden und in der Druckgraphik zu wichtigen Innovationen geführt. Mit seiner Gegengeschichte der neuzeitlichen Kunst macht Werner Busch sichtbar, welche Möglichkeiten eine Kunst abseits der offiziellen Doktrin hatte und wie sie die Kunst der Moderne vorbereitete.

Hohe Theorie muss nicht sein, doch das Handwerk gilt es zu kennen: Werner Buschs Geschichte des unklassischen Bildes bietet eine Fülle von Einsichten.
Wer ein Gemälde als Kunstwerk betrachtet, wird sich auch dafür interessieren, wie es gemalt ist. Die Lasuren Raffaels mögen vollkommen transparent erscheinen, ihre Eigenschaften sind um nichts weniger bemerkenswert als das Farbrelief Willem de Koonings. Die Entwicklung der neuzeitlichen Malerei war allerdings von einem gewissen Widerstand gegen das allzu deutliche Hervorkehren von Stofflichkeit begleitet, so als würden Maler, die ihre Leinwände in eine schrundige Pigmentlandschaft verwandeln, ihre Kunst der bloßen Materie ausliefern. Dieser Vorbehalt fand die verschiedensten Formulierungen, die oft mit dem Versuch, die Malerei aus dem Schmutz des Handwerks in die Geistigkeit der Akademien zu heben, verbunden waren.
Für solche Theoriegebäude hat Werner Busch nicht viel übrig, er ist ein Kunsthistoriker, der lieber die Welt des Ateliers erkundet. Seine Vorliebe für die Meister des fleckigen Farbauftrags, von Tizian über Rembrandt bis Constable, der er in seinem neuesten Buch "Das unklassische Bild" nachgeht, führt ihn aber auch an unerwartete Orte wie die Werkstätten der Holzschnittkünstler, Kupferstecher oder Lithographen, in deren Übersetzungsarbeit er einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung für tonale Übergänge und Differenzierungen sieht.
Reproduktionsgrafik, lange Zeit vernachlässigtes Material, hat sich in den letzten zwanzig Jahren als überaus ergiebiger Forschungsgegenstand der Kunstgeschichte etabliert. Die kulturwissenschaftliche Konjunktur von "Medium" und "Materialität" hat zweifellos das Ihre dazu beigetragen, nicht weniger jedoch eine neu entfachte Begeisterung für die stupenden technischen Möglichkeiten von Kupferstich, Mezzotinto, Crayonmanier und auch Lithographie.
An Bewunderung für diese Leistungen fehlt es Busch nicht, er verfügt zudem über seltene Kennerschaft und erst recht die Lust, sie dem Leser an entlegenen Beispielen vorzuführen. Er ist auch insofern Connaisseur, als er vor idiosynkratischen Urteilen nicht zurückschreckt. Eigenwillen braucht in der Tat, wer die englische Kunst des 18. und 19. Jahrhunderts, einschließlich der Clairobscur-Holzschnitte John Baptist Jacksons oder der Mezzotinto-Blätter eines James MacArdell, Valentine Green oder George Kealing in das Zentrum der neuzeitlichen Kunstgeschichte rückt, um von dort auf die Alten Meister zurück- und zugleich der Moderne entgegenzublicken. Und als wäre dies der Englishness nicht genug, wird der sesshafte Constable noch über den Kosmopoliten Turner erhoben, hinter dessen Farbschleier Busch ein akademisch-klassisches Programm wittert, das durch "Literarisierung" und "kunsttheoretische Kompetenz" eine internationale Öffentlichkeit ansprechen sollte.
Was Busch zu den Engländern zieht, lässt sich nicht allein auf seine Sympathie für insulare Eigenbrötlerei zurückführen. Er sieht in ihnen vielmehr die Initiatoren eines universalen Projekts, das die frühneuzeitliche Farbmalerei mit der modernen Wissenschaft verbindet und zugleich die ästhetische Moderne vorbereitet, indem alle drei auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet werden: auf die "Verfeinerung des Sehens".
Die Mezzotinto des 18. Jahrhunderts interessiert Busch daher auch nicht nur aufgrund ihrer handwerklichen Brillanz, sondern weil die Bemühungen um möglichst feine tonale Abstufungen mit der zeitgenössischen physiologischen Forschung korrespondierten. Constable zeichnet sich nicht nur durch seine Treue gegenüber der heimatlichen Landschaft und den eigenen Gefühlen aus, er war vermutlich auch der erste Maler, der den Regenbogen korrekt darstellte. Selbst Turner kommt in diesem Zusammenhang gut weg, insofern seine Gemälde und auch Ruskins berühmte Beschreibungen durch zeitgenössische Wahrnehmungstheorien informiert waren.
So viel Wissenswertes Busch zum Helldunkel in Malerei, Druckgrafik und Naturforschung zusammengetragen hat, sein übergreifendes Argument einer kontinuierlichen Verfeinerung des Sehens reizt zu kritischen Nachfragen, zumal sich Busch auf das Gebiet der Wissenschaftsgeschichte begibt, wo dieses empiristische Fortschrittsideal nicht gerade hoch im Kurs steht.
Aber auch vor dem Hintergrund von Buschs kunsthistorischer Argumentation sind Vorbehalte angebracht, wenn er schreibt, von Constable bis Seurat "steigen die künstlerische Darstellungskompetenz und die Wahrnehmungskompetenz der Betrachter - eindeutig auf Kosten vermittelbarer konventioneller Inhalte". Der ästhetischen Moderne einen Verlust an Inhalt zu attestieren ist eine bekannte These. Aber kann auf der Habenseite tatsächlich ein Zuwachs an Kompetenzen verbucht werden? Im Kapitel über Wolkenstudien legt Busch überzeugend dar, welch große Bedeutung Constable seinen wechselnden Gefühlsstimmungen zumaß. Der Romantiker verstand seine künstlerischen Neuerungen keineswegs als Kompetenzsteigerung, und die Modernen werden ihm darin folgen.
Fortschritt von Darstellungskompetenz und Verfeinerung des Sehens sind nicht Buschs einzige Thesen. Das Buch verdankt seinen Titel einem anderen Anliegen, es möchte eine "Gegengeschichte zur klassisch-akademischen Kunstauffassung" sein. Der subversive Beiklang dieser Formulierung mag überraschen, da von einer Hegemonie des Klassisch-Akademischen ja schon lange nicht mehr die Rede sein kann. Offenbar benötigt Busch, der so kundig über die "nicht-fixierende Linie" eines Tizian oder Rembrandt zu schreiben versteht, klare Fronten. Er begreift Ideal und Natur, modellierendes und atmosphärisches Helldunkel, Zeichnung und Farbe, Gegenständlichkeit und Abstraktion, Werk und Prozess weniger als Gegensätze, denen in verschiedenen kunsttheoretischen Debatten unterschiedliche Bedeutungen zukamen, sondern als Ausprägungen eines einzigen Antagonismus, nämlich desjenigen zwischen Klassischem und Unklassischem. Aber selbst wenn die neuzeitliche Reflexion über Kunst tatsächlich nichts als eine solche simple "Topik" zu bieten hätte, so wäre dies noch lange kein Grund, ihren Dualismus zu wiederholen - am allerwenigsten für einen Kunsthistoriker, der aus einem überquellenden Schatz an Überlegungen zu Haupt- oder bislang verkannten Nebenwerken der Malerei, Zeichnung und Druckgrafik schöpfen kann.
Denn nicht im Entwurf einer Geschichte oder Gegengeschichte, sondern im Reichtum der Beobachtungen liegt die Stärke von Buschs Buch. Der Liebhaber des breiten Pinsels erweist sich selbst als Feinmaler, der dort am meisten sichtbar macht, wo es für den weniger erfahrenen Beobachter gar nicht viel zu sehen gibt: wenn er Rembrandts virtuose Handhabung der widerspenstigen Rohrfeder diskutiert, unterschiedliche Zustände eines Drucks miteinander vergleicht, Tizians verschiedene Versionen des heiligen Sebastian als Dialog des Künstlers mit sich selbst erläutert oder Constables Schwierigkeit, ein Werk zu beenden, an dessen konkreter Arbeitsmethode darlegt. Wäre Busch seiner Begeisterung für das Unklassische mit letzter Konsequenz gefolgt, hätte er auch auf den Anspruch verzichten können, dem Klassischen ein Gegenmonument an die Seite zu stellen - um sich stattdessen der bunten Vielfalt seiner Gegenstände und Ideen anzuvertrauen.
RALPH UBL
Werner Busch: "Das unklassische Bild". Von Tizian bis Constable und Turner. Verlag C. H. Beck, München 2009. 341 S., 134 Farb- u. S/W-Abb., geb., 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Kia Vahland begrüßt Werner Buschs Geschichte des "unklassischen Bildes". Sie sieht den Kunsthistoriker anknüpfen an die neuere Tizianforschung, die sich mit den Malprozessen des Künstlers auseinandersetzte. Überzeugend zeigt der Autor für sie den Weg auf, den die seit Tizian und seinen venezianischen Kollegen wirkende Tradition einer anti-ikonografischen, anti-formvollendeten Kunst genommen hat. Die große Stärke des Buchs ist in ihren Augen Buschs "Arbeit am Bild", das Geschehen im Atelier, die Arbeitsweisen und -Techniken der Künstler. Besonders hebt sie Ausführungen über die Sebastianfiguren Tizians und Rembrandts Jakob hervor. Wie deren Techniken in die Moderne wanderten, vollzieht Busch zur Freude Vahlands auf "schmalen, aber aussichtsreichen Nebenwegen" nach.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH