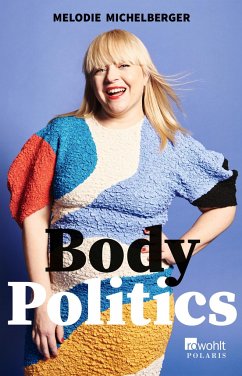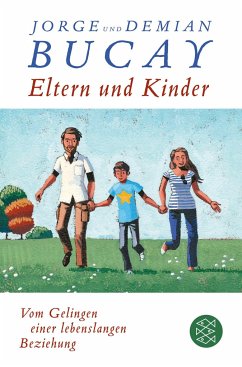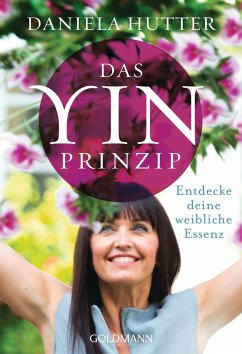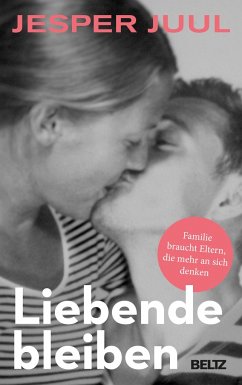Das Unwohlsein der modernen Mutter

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Versorgerin, Businesswoman, Mom I'd like to fuck - Mütter sollen heute alles sein. Dass darunter ihr Wohlbefinden leidet, ist kein Wunder. Mareice Kaiser, Journalistin und selbst Mutter, stellt immer wieder fest: Das Mutterideal ist unerreichbar und voller Widersprüche. Nichts kann man richtig machen und niemandem etwas recht. Mutterschaft berührt dabei, natürlich, jeden Lebensbereich: Denn egal, ob es um Arbeit, Geld, Sex, Körper, Psyche oder Liebe geht - Stereotype, Klischees und gesellschaftlichen Druck gibt es überall, auf Instagram, im Bett und im Büro. Mareice Kaiser zeigt, wo Mü...
Versorgerin, Businesswoman, Mom I'd like to fuck - Mütter sollen heute alles sein. Dass darunter ihr Wohlbefinden leidet, ist kein Wunder. Mareice Kaiser, Journalistin und selbst Mutter, stellt immer wieder fest: Das Mutterideal ist unerreichbar und voller Widersprüche. Nichts kann man richtig machen und niemandem etwas recht. Mutterschaft berührt dabei, natürlich, jeden Lebensbereich: Denn egal, ob es um Arbeit, Geld, Sex, Körper, Psyche oder Liebe geht - Stereotype, Klischees und gesellschaftlichen Druck gibt es überall, auf Instagram, im Bett und im Büro. Mareice Kaiser zeigt, wo Mütter heute stehen: noch immer öfter am Herd als in den Chefetagen. Und, wo sie stehen sollten: Dort, wo sie selbst sich sehen - frei und selbstbestimmt.