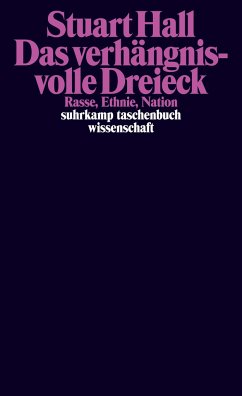In diesem postum veröffentlichten Buch über das verhängnisvolle Dreieck von Rasse, Ethnie und Nation zeichnet der große Soziologe Stuart Hall nach, wie unterdrückte Minderheiten neue Repräsentationsformen von kultureller Identität durchzusetzen begannen - und wie sich dagegen immer wieder Widerstand formierte. Ausgehend von den Kämpfen und begrifflichen Neudefinitionen, die im 20. Jahrhundert von der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und von Migrantinnen und Migranten in westlichen Gesellschaften durchgesetzt wurden, zeigt Hall, wie Identitäten und Vorurteile im Medium der Sprache transformiert werden können. So entstehen immer wieder neue Anstöße, um den Bedrohungen des Fundamentalismus und des Nationalismus zu begegnen. Ein Grund zur Hoffnung.
»[Es] bestehe angesichts der Kultur der Differenz die Aufgabe der Theorie nicht darin, 'weiterhin so zu denken wie bisher und sich den Glauben dadurch zu bewahren, dass sie das Terrain durch einen zwanghaften Willensakt zusammenhält, sondern zu lernen, anders zu denken'. Diese Aufforderung ist aktueller denn je.« Andreas Eckert DIE ZEIT 20180927
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Der hier rezensierende Soziologe Valentin Feneberg kann nur staunen über die Aktualität und die Gültigkeit der 1994er Harvard-Vorlesungen des Mitbegründers der "Cultural Studies", Stuart Hall. Hall erklärt dem Rezensenten nicht nur, warum Zuschreibungen nach Rasse und Nation so unerschütterlich sind, sondern auch, warum sich der Begriff der "Ethnizität", und zwar einer offenen, diskursiven Form davon, besser dazu eignet, kulturelle Unterschiede zu erfassen. Am besten nachvollziehbar ist der Autor für Feneberg, wenn er den Poststrukturalismus hinter sich lässt und historisch, politisch beobachtet und argumentiert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH