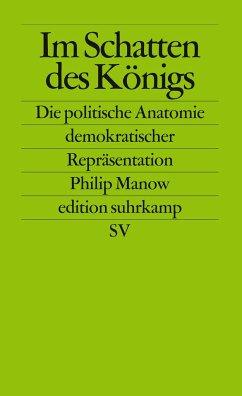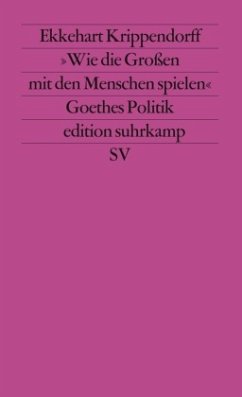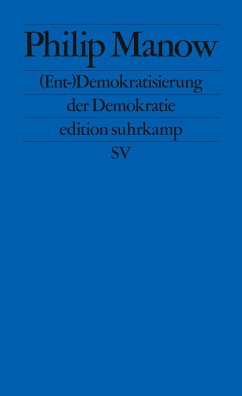Das Verschwinden der Politik
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
18,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Als »Wissenschaft des Regierens« und »Kunst der Verwaltung« definiert ein Lexikon aus dem 18. Jahrhundert die Politik, 2000 Jahre früher machte Aristoteles das »glückselige und edle Leben« als Zweck des Staates aus. Ein Blick auf die Rituale der Berliner Republik zeigt, wie weit sich die praktische Politik von diesen Idealen entfernt hat: Es geht weniger um die Glückseligkeit der Bürger als um Parteienproporz und Lobbyinteressen, das zähe Ringen um Reformen hat mit großer Kunst wenig gemeinsam. Wie es trotzdem immer wieder gelingt, die Fiktion einer idealen Politik aufrechtzuerhalt...
Als »Wissenschaft des Regierens« und »Kunst der Verwaltung« definiert ein Lexikon aus dem 18. Jahrhundert die Politik, 2000 Jahre früher machte Aristoteles das »glückselige und edle Leben« als Zweck des Staates aus. Ein Blick auf die Rituale der Berliner Republik zeigt, wie weit sich die praktische Politik von diesen Idealen entfernt hat: Es geht weniger um die Glückseligkeit der Bürger als um Parteienproporz und Lobbyinteressen, das zähe Ringen um Reformen hat mit großer Kunst wenig gemeinsam. Wie es trotzdem immer wieder gelingt, die Fiktion einer idealen Politik aufrechtzuerhalten, ist das Thema der Studie von Wolfgang Fach: Charismatische Persönlichkeiten »veredeln« die graue Routine, demokratische Wahlen sollen das politische Tagesgeschäft »reinigen«. Wo diese Verfahren nicht weiterhelfen, muß die Politik neu erfunden werden.