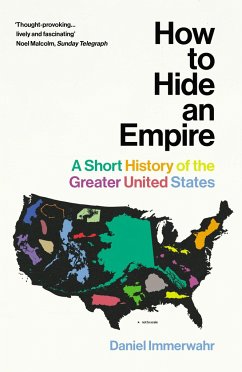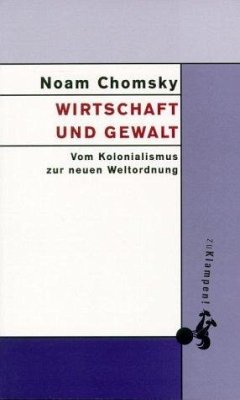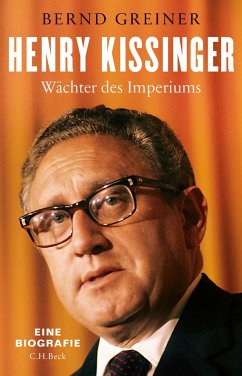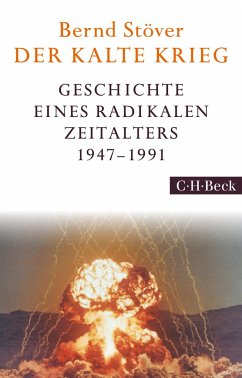Das Zeitalter der Interdependenz
Globales Denken und internationale Politik in den langen 1970er Jahren

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Sozialwissenschaftliche Debatten über globale Verflechtungen zwischen den 1960er und den 1980er Jahren.Ab den späten 1960er Jahren diskutierten Zeitgenossen intensiv über globale Verflechtungen in Weltpolitik und Weltwirtschaft. Mehr als ein Jahrzehnt vor dem Einsetzen der Globalisierungsdebatte erklärten sie ihre Gegenwart zum »Zeitalter der Interdependenz«. Martin Deuerlein untersucht für die USA und die Sowjetunion erstmals umfassend solche globalistischen Gegenwartsdiagnosen in den Sozialwissenschaften und ihre Wechselwirkungen mit der internationalen Politik. Der Autor zeigt, wie d...
Sozialwissenschaftliche Debatten über globale Verflechtungen zwischen den 1960er und den 1980er Jahren.Ab den späten 1960er Jahren diskutierten Zeitgenossen intensiv über globale Verflechtungen in Weltpolitik und Weltwirtschaft. Mehr als ein Jahrzehnt vor dem Einsetzen der Globalisierungsdebatte erklärten sie ihre Gegenwart zum »Zeitalter der Interdependenz«. Martin Deuerlein untersucht für die USA und die Sowjetunion erstmals umfassend solche globalistischen Gegenwartsdiagnosen in den Sozialwissenschaften und ihre Wechselwirkungen mit der internationalen Politik. Der Autor zeigt, wie das im 19. Jahrhundert etablierte Verständnis von Interdependenz als Verflechtung nationaler Einheiten ab den 1960er Jahren hinterfragt wurde. Die Zunahme von Welthandel und Finanzströmen, »globale Probleme« wie Hunger und Umweltverschmutzung und die neue Bedeutung multinationaler Unternehmen und anderer transnationaler Akteure ließen Beobachter an bisherigen Annahmen zweifeln. Vor dem Hintergrund des Ost-West- und des Nord-Süd-Konflikts wirkte globale Verflechtung zunehmend bedrohlich und schien neue politische Ansätze zu erfordern. Wie eine den gewandelten Rahmenbedingungen angepasste Weltordnung jedoch aussehen sollte, war heftig umstritten - eine Frage, die bis heute nichts von ihrer Relevanz verloren hat.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.