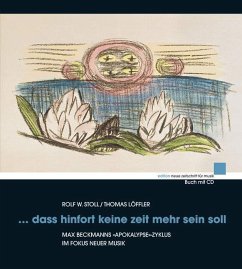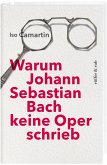In den Jahren 1941/42 schuf Max Beckmann im Amsterdamer Exil eine Lithografienfolge zur Offenbarung des Johannes mit dem Titel "Apokalypse". Die KomponistInnen Volker Blumenthaler, Adriana Hölszky, Nicolaus A. Huber, Jan Kopp und Benjamin Schweitzer haben zu diesem Zyklus Auftragswerke für das Ensemble Phorminx geschrieben. Buch und CD führen die Einspielungen dieser Stücke mit dem Lithografienzyklus und Beiträgen über Beckmanns Werk wie über die Kompositionen zusammen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Kompositionsaufträge zu Beckmanns "Apokalypse"
Ein mehr als 1900 Jahre alter Text, eine Summe großer und mutiger menschlicher Handlungen, die ihn mit 27 Bildern verknüpft, reflektiert in fünf Kompositionen, gebündelt in einer Kombination aus CD, Kunstdruck und Gedankenfutter: Mehrdimensionaler geht es kaum und bemerkenswerter auch nicht. Als "entartet" verfemt harrte Max Beckmann im besetzten Amsterdam aus, als der Frankfurter Druck-Unternehmer Georg Hartmann ihn 1941 beauftragte, eine bibliophile Ausgabe der Offenbarung des Johannes zu illustrieren. Die in einer Auflage von mindestens 42 Büchern enthaltenen handkolorierten Lithographien Beckmanns wurden erst vor wenigen Jahren wiederentdeckt. Freunde des Ensemble Phorminx erwarben überraschend eine Ausgabe. Im Ensemble war man tief beeindruckt: Der seine Existenz riskierende Hartmann, der seinem Malverbot zuwiderhandelnde Beckmann, die Menschen, die das Werk in verschiedenen Stadien seines Entstehens mehrfach zwischen Amsterdam und Frankfurt hin und her transportierten - "uns faszinierte, dass Kunst in dieser extremen Krisensituation ein solch hoher Stellenwert eingeräumt und dass sie für unverzichtbar gehalten wird", kommentierten die Ensemblemitglieder Angelika Bender und Thomas Löffler den Fund. Die Begeisterung erfasste auch einen Kreis von Förderern. So konnte das Ensemble fünf Kompositionsaufträge vergeben, in denen das Sujet auf höchst unterschiedliche Weise zum Tragen kommt.
Für Nicolaus A. Huber forderten "der blutrünstige Ton, das kategorische Freund-Feind-Denken (alles dem Zorn Gottes unterschoben), der Chauvinismus" eine offene Rebellion heraus. Seine Komposition "Die Leber des Prometheus" gipfelt im von Carola Schlüter gesprochenen Zitat von Charles Bukowski: "schlechter Whisky / schlechter Atem . . . und zum Teufel mit dem nächsten Morgen". Der 1971 geborene Jan Kopp zeigte sich von der Distanz beeindruckt, in die Beckmann die geschilderten Vorgänge rückt: Oft gewährt er ihnen nur durch ein Fenster Einlass in das Bild, auf dem er im Wesentlichen seine eigene innere Emigration darstellt. "In ihrer Schlichtheit muten die Grafiken an wie Kammermusik, während nebenan die Presslufthämmer arbeiten", befand Jan Kopp und schuf analog dazu ein dichtes Stück Kammermusik - als einladende Insel, auf die man sich aus jedweder Unwirtlichkeit zurückziehen kann. Vorausgesetzt, man nimmt nicht die eigene innere Hölle dorthin mit, die Adriana Hölszky in ihrer Komposition "Lemuren und Gespenster" so lustvoll ironisch wie klangmalerisch gekonnt thematisiert. "Durch die Benennung dieser Abgründe werden die Lemuren und Gespenster der Schattenwelten gebannt", fügt sie in ihrem Werkkommentar hinzu. Dem Komplex einer außerhalb von Zeit angesiedelten Wahrheit, dem Andreas Hansert, Wolfgang Lessing und Ernst Wagner sich in ihren Wortbeiträgen nähern, wird in den Kompositionen von Volker Blumenthaler und Benjamin Schweitzer mit musikalischen Mitteln nachgegangen: in der Aufhebung der Metrik bei Blumenthaler, in einer nichtlinearen Gesamtform bei Schweitzer.
Sämtliche Kompositionen erfahren durch das Ensemble Phorminx mit der Flötistin Angelika Bender, der Geigerin Mariette Leners, dem Cellisten Wolfgang Lessing, dem (Bass-)Klarinettisten Thomas Löffler, der Sängerin Carola Schlüter und dem Pianisten Andreas Sommer eine Interpretation voll solidarischer Liebe zum Detail und akrobatischer Klangerzeugungskunst. Sie wurde beim Hessischen Rundfunk mit so hoher Tiefenschärfe eingespielt, dass man sich zum angemessenen Goutieren am besten unter Kopfhörern von der real existierenden Geräuschwelt zurückzieht. Ein Kunstwerk in sich ist auch der Textabdruck mit seiner Reibungsenergie zwischen Lutherdeutsch, ostinater Kleinschreibung und der lesefreundlich-luftigen Palatino-Typographie, die der seinerzeit für Hartmann entworfenen "Futura" sehr nahe kommt. Dieser Schatz ist unbezahlbar und kostet doch nur 29,90 [Euro].
ELISABETH RISCH
". . . dass hinfort keine zeit mehr sein soll". Max Beckmanns "Apokalypse"-Zyklus im Fokus neuer Musik. Herausgegeben von Rolf W. Stoll und Thomas Löffler in der Reihe "edition neue zeitschrift für musik". Schott Music NZ 5018.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main