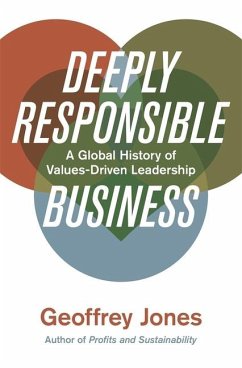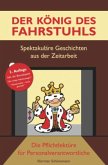Deeply Responsible Business profiles corporate leaders of the past two centuries who made social missions vital to their businesses. Geoffrey Jones explores the characters and motivations of fourteen such leaders and compares their deep social and environmental commitments to the lukewarm "corporate social responsibility" of today.

Eine globale Geschichte der Ethik in Unternehmen
Ist der Kapitalismus grundsätzlich destruktiv? Verursacht er ökologische Katastrophen und soziale Ungleichheit? Geht es ihm allein um den privaten Profit? Das Buch des an der Harvard Business School lehrenden Unternehmenshistorikers Geoffrey Jones sucht nach nuancierten Antworten auf diese Fragen. Es zeigt, dass es seit der Industrialisierung immer auch Unternehmer gab, die eine Verantwortung jenseits der Gewinnerzielung und jenseits ihrer Unternehmen ernst nahmen. Corporate Social Responsibility ist keine Erfindung der letzten Jahrzehnte, auch wenn die rhetorischen Wortmühlen gegenwärtig immer lauter klappern.
Ernst gemeintes wertebasiertes Unternehmertum jenseits durchsichtiger PR-Kalküle war und ist in der Geschäftswelt ein Minderheitenphänomen, aber keineswegs irrelevant. Es stellt das Allgemeinwohl gleichberechtigt neben oder sogar über den Gewinn. Dabei spielten religiöse Überzeugungen eine große Rolle, wobei nicht nur im Sinne Max Webers der Protestantismus hervorsticht, sondern auch andere Bekenntnisse vom Islam und Hinduismus bis zum Jainismus oder dem Katholizismus. Sie alle postulierten ethische Grundsätze, die das Verhalten von Unternehmern prägen. Daneben stehen einflussreiche philosophische Denkschulen vom Konfuzianismus bis zur Anthroposophie.
Ethisch geprägte Ansätze der Unternehmensführung fanden ihren Niederschlag in drei Bereichen. Erstens in der Produktpolitik. Der Quäker George Cadbury wollte den Alkoholismus mit schmackhafter Trinkschokolade bekämpfen, Anita Roddick (Body Shop) eine Alternative zu Chemie und Tierversuchen in der Kosmetikindustrie schaffen und Yvon Chouinard (Patagonia) ökologisch unbedenkliche Outdoorkleidung anbieten. Der Mormone George Romney hielt im Einklang mit seiner Kirche exzessiven Konsum für einen Frevel. Sein Unternehmen AMC baute in den 1950er-Jahren daher verbrauchsarme Kleinwagen, als spritfressende Straßenkreuzer mit gigantischen Heckflossen gefragt waren. Daher blieben die Verkäufe enttäuschend. Anders erging es der ökologischen Landwirtschaft und dem Handel mit ihren Produkten. Beide Branchen wuchsen seit den 1970er-Jahren von einer Nische aus zu einem dynamischen Marktsegment.
Zweitens ging es um den respektvollen Umgang mit anderen Stakeholdern von den Beschäftigten bis zu den Kunden, von der sozialen bis zur ökologischen Umwelt. Jones liefert viele Beispiele dafür, dass Unternehmer sich um anständige Wohnungen und kostenlose Gesundheitsfürsorge für ihre Beschäftigten kümmerten, sie über Tarif bezahlten und die Belastungen der Umwelt freiwillig reduzierten. Die Sorge um das Gemeinwohl konnte sich auch im politischen Engagement ausdrücken. In Indien stellten sich zahlreiche Geschäftsleute auf die Seite von Gandhi und gegen die britische Kolonialherrschaft. Drittens waren verantwortungsvolle Unternehmen im "community building" aktiv, indem sie die Lebensbedingungen in ihren Städten verbesserten, Schulen und Krankenhäuser bauten und das Gemeinwohl überall dort förderten, wo die öffentliche Hand versagte.
Es spricht für die Qualität des Textes, dass er an keiner Stelle Heiligenviten auf den Leim geht. Er schildert zumeist ambivalente Persönlichkeiten, die Gutes anstrebten, aber nicht immer erreichten oder auch Gutes und Schlechtes nebeneinander hervorbrachten. Soziale Fürsorge ging oft mit Patriarchalismus und Machtdemonstrationen einher. Der von der Lebensreformbewegung inspirierte Robert Bosch ließ seiner Heimatstadt hohe Summen zukommen und stand dem Widerstand gegen Hitler nahe, stellte sein Unternehmen aber in den Dienst der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft, verdiente daran prächtig und beschäftigte massenhaft Zwangsarbeiter. Er vererbte die Mehrheit der Anteile an seinem Unternehmen an eine allgemeinnützige Stiftung. Die Robert Bosch AG wurde ein sehr erfolgreiches Stiftungsunternehmen, das nur acht Prozent seines Gewinns an private Anteilseigner, die Erben Robert Boschs, ausschüttet, während der Großteil über die Stiftung für Gesundheit und Bildung verwendet wird. Überhaupt bieten gemeinnützige Stiftungsunternehmen einen guten Schutz gegen die Erosion der Wertebasis und natürlich auch gegen feindliche Übernahmen. Während bei Bosch die Allgemeinwohlorientierung im Laufe der Zeit zunahm, war es bei vielen anderen Unternehmen umgekehrt. Das Wachstum aus den überschaubaren Dimensionen eines Familienunternehmens heraus und der Einstieg externer Manager und Investoren schwächten häufig die wertebasierte Ausrichtung.
Das Buch nimmt den Leser mit auf eine Reise vom 19. bis zum 21. Jahrhundert, von Europa über Amerika nach China, Indien und Nordafrika. Es ist faszinierend, zu sehen, unter welch unterschiedlichen Bedingungen Unternehmer persönlich Verantwortung übernahmen, ohne jedoch die Probleme jemals vollständig zu lösen. Ihr Beitrag zu ihrer Milderung war jedoch erheblich. Neben einer Vielzahl unterschiedlicher Fallstudien behandelt das Buch auch die Rolle von Business Schools, die lange ihre Absolventen auf ihre Verantwortung jenseits von Bilanzen hinwiesen, aber seit den 1980er-Jahren den Sirenenklängen der Shareholder-Value-Doktrin erlagen. Erst in den letzten Jahren gibt es eine Gegenbewegung, in die sich auch dieses anregende Buch einordnet. HARTMUT BERGHOFF
Geoffrey Jones: Deeply Responsible Business. A Global History of Values-Driven Leadership, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2023, 448 Seiten, 35 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main