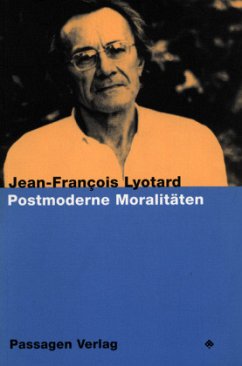Dekonstruktion und Pragmatismus
Demokratie, Wahrheit und Vernunft
Herausgegeben: Mouffe, Chantal;Mitarbeit: Rorty, Richard; Derrida, Jacques
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
22,60 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Eingeleitet von Chantal Mouffe, sind die Diskussionsbeiträge sowohl grundlegende Positionsbestimmungen als auch geeignete Einführungen in die Philosophie der Autoren.Dekonstruktion und Pragmatismus, die beiden zur Zeit einflussreichsten philosophischen Positionen, treten sich hier in direkter Konfrontation gegenüber, um das jeweilige Politikverständnis und dessen Bedeutung für die Demokratien am Ende des Jahrtausends zu konturieren. Wo das Konzept Demokratie jenseits von universalistischen Fundierungen, "Vernunft" und "Wahrheit" bedacht wird, treten entscheidende Differenzen, aber auch Ü...
Eingeleitet von Chantal Mouffe, sind die Diskussionsbeiträge sowohl grundlegende Positionsbestimmungen als auch geeignete Einführungen in die Philosophie der Autoren.Dekonstruktion und Pragmatismus, die beiden zur Zeit einflussreichsten philosophischen Positionen, treten sich hier in direkter Konfrontation gegenüber, um das jeweilige Politikverständnis und dessen Bedeutung für die Demokratien am Ende des Jahrtausends zu konturieren. Wo das Konzept Demokratie jenseits von universalistischen Fundierungen, "Vernunft" und "Wahrheit" bedacht wird, treten entscheidende Differenzen, aber auch Übereinstimmungen deutlich zutage.Zwischen individueller Autonomie und dem Streben nach sozialer Gerechtigkeit sondieren die Beiträge ein Terrain radikalisierter demokratischer Strategien und antworten so auf den immer wieder an "die Postmoderne" erhobenen Vorwurf, allein einem privatistischen oder relativistischen Zynismus zu folgen, der auf lange Sicht nur in ein politisches Chaos führen könne. Richard Rortys und Jacques Derridas Beiträge stecken einen Rahmen ab, in den Simon Critchley und Ernesto Laclau mit eigenständigen, dennoch verwandten Ansätzen intervenieren: Einerseits einer Levinasschen Öffnung zugewandt, bringen sie andererseits Dekonstruktion mit einer Kritik des hegemonialen Denkens in Reibung. Alle Beiträge sondieren somit die Möglichkeiten einer Engführung von Pragmatismus und Dekonstruktion.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.