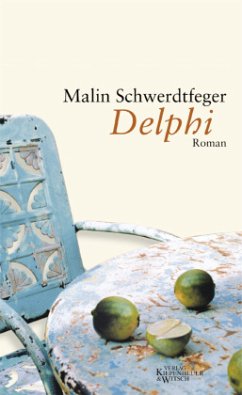Die mitreißende Geschichte einer Familie von Getriebenen
"Delphi" erzählt eine Familiensaga zwischen griechischen Tempeln, Jerusalemer Steinen und norddeutschen Deichen - mit farbenprächtigen Bildern, trockenem Humor und einer Feinfühligkeit, die in der jungen deutschen Literatur ihresgleichen sucht.
Alles beginnt in Delphi: Die verwackelten Bilder einer Amateurkamera zeigen einen Mann, der vor dem Apollontempel eine Rede hält. Zwei Kinder spielen zwischen den Ruinen der Orakelstätte. Es sind dieGeschwister Linda und Robbie, die von der Mutter gefilmt werden, während ihr Vater, ein Archäologe, sie in die antike Sagenwelt einführt. Die beiden jüngeren Schwestern sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren, und doch sind sie schon mit dabei, denn eine von ihnen ist die Erzählerin. Mühelos setzt sie sich über Zeit und Raum hinweg und entspinnt die Geschichte einer Familie von Getriebenen, die sich aufmachen, die Welt zu verstehen und ihre eigene Rolle darin zu finden. Der Vater has
"Delphi" erzählt eine Familiensaga zwischen griechischen Tempeln, Jerusalemer Steinen und norddeutschen Deichen - mit farbenprächtigen Bildern, trockenem Humor und einer Feinfühligkeit, die in der jungen deutschen Literatur ihresgleichen sucht.
Alles beginnt in Delphi: Die verwackelten Bilder einer Amateurkamera zeigen einen Mann, der vor dem Apollontempel eine Rede hält. Zwei Kinder spielen zwischen den Ruinen der Orakelstätte. Es sind dieGeschwister Linda und Robbie, die von der Mutter gefilmt werden, während ihr Vater, ein Archäologe, sie in die antike Sagenwelt einführt. Die beiden jüngeren Schwestern sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren, und doch sind sie schon mit dabei, denn eine von ihnen ist die Erzählerin. Mühelos setzt sie sich über Zeit und Raum hinweg und entspinnt die Geschichte einer Familie von Getriebenen, die sich aufmachen, die Welt zu verstehen und ihre eigene Rolle darin zu finden. Der Vater has

Malin Schwerdtfegers Familienroman der Generation Nutella
"Es ist kein Zuckerschlecken, spätentwickelt zu sein und gleichzeitig frühvergreist", schrieb Malin Schwerdtfeger in ihrem klugen "Kursbuch"-Essay "Wir Nutellakinder". "Eine Generation, die nichts geerbt hat, weil ihre Eltern mit sich selbst beschäftigt sind, eine Generation, die nichts erfüllen muß und deshalb auch nicht verstoßen werden und neu anfangen kann, braucht ein wenig länger, bis sie sich erfunden hat."
Für Malin Schwerdtfeger sind alle Nachteile der Popliteratur - frühvergreiste Altklugheit, Dingfetischismus, kollektive Erinnerungsseligkeit - Vorboten eines unbewußten "Ripleytums". Wie der talentierte Mr. Ripley haben die Waisenkinder von 1968 von ihren Eltern weder Traditionen und Werte geerbt noch Erwartungen in die Wiege gelegt bekommen. Die Generationenkette ist gerissen, und so schließen sich die Nutella-Kinder, allein gelassen mit ihrer Freiheit und nach jedem Identitätsfummel haschend, ihren Großeltern an und füllen ihr Vakuum mit betulichen Erinnerungen an Schokoriegel (West) oder Mosaik-Heftchen (Ost). Wer die vorgezeichnete Lebensbahn verlassen will und sentimentale Nostalgie verachtet, erwirbt sich Attribute und Biographie eines Ichs am besten durch den Mord am bessergestellten Doppelgänger. "Erinnerungen sind für die Dummen"; begabte Kinder haben keine, jedenfalls keine eigenen.
"Delphi" ist der Familienroman dieser Generation Nutella, ohne die Ironie eines Florian Illies oder den verzweifelten Snobismus eines Christian Kracht. Die Pointe - und der Haken - dabei ist: Das Medium der Erinnerung, die anonyme Erzählerin, ist selber schon tot. Sie teilt dieses Schicksal (wie auch den Hang zur skurrilen Morbidität) mit Jens Behse, dem Erzähler von Marcus Jensens Roman "Oberland": Auch dieser mit seinen Achtundsechziger-Eltern hadernde Zivi lebte und starb ja für sein Credo "Souverän ist, wer tot guckt". "Nicht die Lebenden erzählen von den Toten", heißt es in "Delphi", "sondern umgekehrt": Offenbar sind die Kinder der Revolte mit dem Leben fertig, ehe es richtig begonnen hat.
In Schwerdtfegers Roman wachsen vier Kinder in der grenzenlosen Wohlstandsverwahrlosung einer exterritorialen Diplomatenwelt auf und verschwören sich, frei durch Raum und Zeit flottierend, zu einer autistischen Schicksalsgemeinschaft. Der Vater, ein Archäologe, der in Jerusalem, Delphi und auf dem Parnaß die Vergangenheit ausgräbt, ist in der Gegenwart fremd und selten zu Hause. Die hysterische, labile Mutter, von Haushalt, Kindererziehung und der nomadischen Existenz überfordert, sucht Ursprung und Heimat in einer chassidischen Sekte und muß am Ende mit Medikamenten ruhiggestellt werden.
So erfinden sich die Waisen-Geschwister in Villen und arkadischen Gärten früh ihre eigene Parallelwelt. Linda, das Wunderkind, "weiß alles und kann alles" und hält sich für unverwundbar. Schon als Zehnjährige studiert sie an der Jerusalemer Universität Ägyptologie, Ethnologie und Kabbala, schreibt Orakel in Hexametern und Hausarbeiten über Jeanne d'Arc. Mit Achtzehn bringt sie ihrem Nachbarn, P. S. Kotopoulis, Aprikosenopfer dar und beißt ihm einen Hemdenknopf weg; in der Liebe hat die überspannte Pythia nämlich wenig Glück. Robbie wacht eifersüchtig und herrisch über seine Schwester, die kleine Pepita verehrt sie abgöttisch.
Das fast inzestuös ineinander verkrallte Dreigestirn wird erst durch Francis gesprengt. Francis ist erst neunzehn und schon gutsituierter Antiquitätenhändler: ein frühvergreister Ripley, der Opium aus dem antiken Dreifuß raucht und mit altklugen Bonmots provoziert: "Frauen wollen Kinder gebären und keine Sterne. Schreiben ist unangenehm und anstrengend und im Grunde männlich. Man muß sich überwinden. Und das ist für den weiblichen Körper überhaupt nicht gesund."
Der Dandy behält recht: Das vierte, namenlose Kind wird erst nach seinem Tod Autorin. Die mythomane Erzählerin hat weder ein Gesicht noch eine eigene Geschichte; dafür kann sie die ganze Weltgeschichte im Zeitraffer sehen: Die Geschichte der Juden bis hin zur Intifada, die Mumien Ägyptens, Sagen und Götter der alten Griechen und auch die Wasserleichen, die Großvater Jopie auf seinem Seemannsfriedhof hinter dem Deich bestattet. Klaglos läßt sie sich von ihren Geschwistern übersehen und wegschubsen; ungerührt duldet, kaltblütig beschreibt sie Wahn und Zwangsneurosen ihrer Mutter, den strengen Pragmatismus von Großmutter Generosa und Lindas kapriziöse Exaltiertheiten. Sie ist die Idiotin der Familie und ihre getreue Chronistin, und wenn sie am Ende, durch Lindas Schuld, im Wattenmeer ertrinkt, ist auch das sub specie aeternitatis kein Unglück: Linda wird dadurch endlich erwachsen, "Delphi" zum mythologischen Bildungsroman. Alles, was geschieht, "selbst die kleinste Kleinigkeit", hinterläßt Spuren, die nicht getilgt werden und alles verändern können.
"Ein Chronist, der auf seine Erinnerungen angewiesen ist, kann sich selbst nicht trauen", heißt es im Prolog: Die Schwerkraft des Körpers fesselt ihn an Erde und Gegenwart. Das Leben ist eine Reihe von verwackelten Acht-Millimeter-Filmchen, "stumme Drei-Minuten-Erinnerungen von prophetischer Willkür", die erst postmortal entwickelt und scharf werden. "Erinnerungen sind für Leute, die sich selbst und einander ständig versichern müssen, daß es sie gibt", und so kann die Muse der Erinnerung erst im Tod zur Ruhe und zu sich kommen. "Ich muß nicht mehr an sie erinnern, weil ich sie alle bin", brüstet sie sich im Epilog. "Ich muß mich nicht erinnern. Ich bin die Erinnerung."
Das klingt als ästhetisches Programm nicht übel; aber die Leer- erweist sich als Schwachstelle des Romans. Erzählen als eine Art rückwärtsgewandtes Orakel: Göttlich unbewegt und allwissend spricht eine Stimme aus dem Totenreich. Jeder historische Augenblick ist gleich nah zu Gott, jede Erinnerung klar und unverrückbar wie ein Stein in der Klagemauer: "Schoschana weinte nicht um ihr Haar. Sie weinte nicht um sich selbst. Sie weinte aus Gründen, die viel älter waren als sie selbst. Sie weinte aus urvordenklichen Gründen." So, frei von Gefühlen, Zweifeln, Irritationen und Erinnerungslücken, entfaltet die Erzählerin die hermetischen Privatkosmologien der Geschwister und bindet sie an urvordenkliche Mythen zurück. Mehr noch als Linda ist sie ein Wunderkind, und daß sie vom Jenseits aus manchmal ziemlich mädchenhaft Tagebuch führt, ist nicht das kleinste Wunder.
Ihr Wissens- und Entwicklungsvorsprung macht Wunderkinder oft zu Außenseitern und den Älteren zutiefst verdächtig. Sie ziehen sich vor Hänselei und Bewunderung gern in Phantasieräume zurück und hüten eifersüchtig die Schlüssel zu ihrem Paradies. Das gilt für die Brontë-Schwestern, für die als "Schlauberger" verkannte Linda und leider auch für Malin Schwerdtfeger. Mit ihrem "Café Saratoga" etablierte sie sich als Wunderfräulein der deutschen Literatur. Jetzt hat sie wieder einen Roman voller Bildungsmythen, magischem Realismus und feingesponnenem Humor vorgelegt; aber man wird in den Wunderkammern ihrer kalten Virtuosität nicht recht heimisch. Der Leser fühlt sich wie ein störender Eindringling, und die talentierte Mrs. Ripley baut seiner Neugier keine Brücken. So bleiben die Erinnerungen der lebenden Toten tot, ein Familienalbum ohne Subjekt, eine archäologisch sterile Sammlung glänzender Scherben und Erinnerungssplitter, so willkürlich und vieldeutig wie delphische Orakel.
MARTIN HALTER
Malin Schwerdtfeger: "Delphi". Roman. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2004. 296 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Kai Martin Wiegandt kann sich für den neuen Roman von Malin Schwerdtfeger nicht erwärmen. Im Mittelpunkt des Buches steht das Geschwisterpaar Robbie und Linda, die an so verschiedenen Orten wie Jerusalem, Athen, Delphi und Norddeutschland aufwachsen und deren Mutter sich dem orthodoxen jüdischen Glauben zuwendet und schließlich wahnsinnig wird, versucht der Rezensent den Handlungsverlauf zusammenzufassen. Erzählt wird der Roman dabei von einer namenlosen dritten Schwester, "mehr Geist als Fleisch", die sich als "undisziplinierte auktoriale" Erzählerinstanz der Chronologie der Geschehnisse verweigert, erklärt der Rezensent weiter. Das Hauptproblem ist für Wiegandt der "magische Realismus", der neben dem mitunter allzu "harmlosen" Erzählton die durchaus dramatischen Ereignisse "wie in Watte" packt und damit ihre Wirkung unterminiert. Für den enttäuschten Rezensenten scheitert der Roman am Konzept, obwohl er der Autorin durchaus "handwerkliches Geschick" attestiert. Denn dadurch, dass Schwerdtfeger Erinnerung als "Ort, wo das wünschen noch geholfen hat" versteht, erlangt auch die Phantasie einen überragenden Stellenwert, und es wird "ganz unerheblich", was geschieht, so der Rezensent missvergnügt. Der Roman wird zum "wilden Traum" den unser Rezensent einfach nicht träumen will.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Virtuos. Der Roman liefert Bilder von gestochener Schärfe.« NZZ