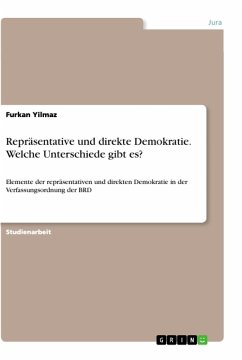Demophobie
Muss man die direkte Demokratie fürchten?
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
24,80 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Noch vor wenigen Jahren sahen alle heute im Bundestag vertretenen Parteien außer der CDU in ihren Partei- oder Wahlprogrammen die Einführung von Volksabstimmungen auf Bundesebene vor. Das entsprach dem Wunsch einer großen Mehrheit der Bürger. Inzwischen hat sich der Wind der öffentlichen Meinung gedreht. Vor allem das Brexit-Votum der Briten und die Erfolge populistischer Politiker und Parteien in vielen Ländern haben neue Skepsis geweckt, ob man politische Sachentscheidungen wirklich "dem Volk" überlassen kann. Was ist davon zu halten? Haben wir es mit einer Rückkehr zum Realismus ode...
Noch vor wenigen Jahren sahen alle heute im Bundestag vertretenen Parteien außer der CDU in ihren Partei- oder Wahlprogrammen die Einführung von Volksabstimmungen auf Bundesebene vor. Das entsprach dem Wunsch einer großen Mehrheit der Bürger. Inzwischen hat sich der Wind der öffentlichen Meinung gedreht. Vor allem das Brexit-Votum der Briten und die Erfolge populistischer Politiker und Parteien in vielen Ländern haben neue Skepsis geweckt, ob man politische Sachentscheidungen wirklich "dem Volk" überlassen kann. Was ist davon zu halten? Haben wir es mit einer Rückkehr zum Realismus oder mit einer Wiederkehr alter, antidemokratischer Vorurteile zu tun? Das Buch geht diesen Fragen nach und zeigt, dass die Chancen und Risiken direkter Demokratie sich nicht ohne genaue Betrachtung der näheren Ausgestaltung beurteilen lassen.Just a few years ago, all parties represented in the Bundestag today except the CDU included in their party or election programs the introduction of referendums at the federal level. This was in line with what a large majority of citizens expressly requested. In the meantime, the winds of public opinion have shifted. Above all, the Brexit vote by the British and the successes of populist politicians and parties in many countries have aroused new skepticism as to whether factual political decisions can really be left to "the people." What are we to make of this? Are we dealing with a return to realism or with a return of old, anti-democratic prejudices? The book explores these questions and shows that the opportunities and risks of direct democracy cannot be assessed without a close look at how it is implemented.