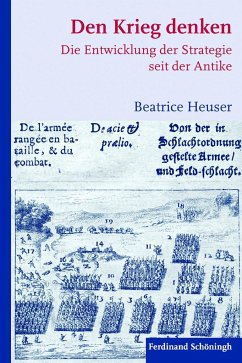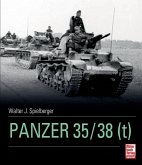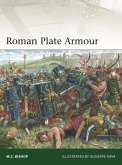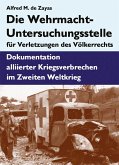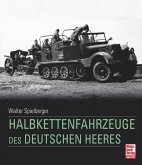Ein großer Wurf, seit langem erwartet: die Geschichte des strategischen Denkens bis zur Gegenwart, verfasst von einer erstrangigen Kennerin. Über die Entwicklung von Strategie zu schreiben, ist eine Herausforderung. Der Inhalt des Begriffs hat sich im Laufe der Geschichte erheblich verändert. Nicht mehr die bloße Kunst des Feldherrn (des strategós) ist Strategie. Ihr Inhalt wird heute vielmehr durch gesellschaftliche Institutionen, Normen und Verhaltensmuster und ganz besonders durch die Politik, von der sie geleitet wird, und die Kultur, von der sie beeinflusst ist, bestimmt. Beate Heuser folgt in ihrer großen Darstellung dem von Clausewitz abgeleiteten heutigen Konsens unter Experten: Strategie ist Einsatz aller verfügbaren Mittel, vor allem des Mittels der Streitkräfte, zu politischen Zwecken, mit dem Ziel, dem Gegner die eigene Politik und den eigenen Willen aufzuzwingen. In einer souveränen tour d'horizon entfaltet sie die westlichen Ideen zum Großen Krieg. An den Anfang stellt sie klassische antike Autoren wie Vegetius und verfolgt dann über die Jahrhunderte hin die Vorstellungen der Verfasser von Schriften über Kriegführung, ob sie nun den Begriff 'Strategie' verwendeten oder nicht (er wurde nach der Antike erst um 1800 wieder gebräuchlich). Die Spannweite umfasst Verfasser und Werke aus Frankreich, Spanien und Italien, Deutschland, England, den USA und Russland bis hin zu aktuellen angelsächsischen Autoren, deren Theorien heute das Themenfeld dominieren.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Gewonnen hat, wer die Gegenseite davon überzeugt, von der Konfrontation zur Kooperation überzugehen: Beatrice Heusers lehrreiche Geschichte des strategischen Denkens.
Strategie ist in Deutschland seit kurzem wieder ein Thema, und zwar keineswegs nur Strategien der Kommunikation oder der Geldanlage, sondern auch und gerade solche der militärischen Gewalt. Das mag mit der Transformation der Bundeswehr in eine Einsatzarmee zusammenhängen, vermutlich aber auch mit den insgesamt größeren Spielräumen, die der deutschen Politik im letzten Jahrzehnt zugewachsen sind, sowie den diffuseren Herausforderungen, mit denen sie sich seit geraumer Zeit konfrontiert sieht. Es gibt wieder eine Vorstellung davon, dass man an einer falschen militärischen Strategie politisch scheitern kann.
Zuletzt ist mit skeptischer Miene des Öfteren die Frage gestellt worden, ob der Westen in Afghanistan überhaupt siegen könne. Aber jede Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wie man Sieg definiert: ob man darunter bloß den Ausgang einer militärischen Konfrontation versteht oder ob damit längerfristige politische Ziele gemeint sind. Kann man es womöglich auch einen Sieg nennen, wenn man die Gegenseite durch seine Beharrlichkeit dazu nötigt, von Konfrontation zu Kooperation überzugehen? Und wenn dem so wäre - ist das eine neue Einsicht, oder gibt es dafür Gewährsleute in der Geschichte des strategischen Denkens?
Beatrice Heusers Buch kommt zum rechten Augenblick. Die historische Tiefe, in der es die wesentlich in Europa entwickelten Strategieentwürfe ausleuchtet, vermag die gegenwärtige Debatte über aktuelle strategische Fragen zu befruchten. Es wäre darum zu begrüßen, wenn nicht nur Berufsmilitärs, sondern auch Politiker und Politikberater es läsen, um sich durch den Gang in die Archive des militärstrategischen Denkens inspirieren, aber auch warnen zu lassen. Eine leichte und eingängige Lektüre ist es freilich nicht, was sie da erwartet. Das hat mit der Sache zu tun, um die es geht, aber auch damit, dass Beatrice Heuser keinen größeren Wert darauf gelegt hat, den Leser mit eingängigen oder provokanten Thesen in die Darstellung hineinzulocken. Man muss sich schon durchkämpfen, um ans Ziel zu kommen.
Ohnehin geht es gar nicht um die Entwicklung von Strategie, sondern es handelt sich um eine Ideengeschichte militärstrategischen Denkens, und die liest sich dort, wo Debatten und Kontroversen dargestellt werden, sehr viel besser als in jenen Abschnitten, wo es mehr um eine Dogmengeschichte herausragender Werke der Militär- und Strategiegeschichte geht. Außerdem sollte man sich von dem im Titel annoncierten zeitlichen Beginn in der Antike nicht irritieren lassen: Im Prinzip wird die Strategiereflexion von der Französischen Revolution bis heute behandelt, und die paar Seiten, die dem römischen Militärschriftsteller Vegetius und einigen seiner byzantinischen Nachfolger gewidmet sind, sind nicht der Rede wert. Antike und Mittelalter sind nicht unbedingt die Stärken der Neuzeithistorikerin Heuser, die nach mehrjähriger Tätigkeit als Abteilungsleiterin am Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Potsdam nunmehr Internationale Beziehungen an der Universität Reading in Großbritannien lehrt.
Umso souveräner sind dagegen die Abschnitte über ein strategisches Denken zwischen totaler Mobilmachung und totalem Krieg, über die Entwicklung von Seekriegsstrategien und schließlich über Luftmacht- und Nuklearstrategien, die das Zentrum des Buches ausmachen. Obendrein kommt der Autorin hier der Umstand zupass, dass es bei fast allen hier relevanten Fragen unterschiedliche, in der Regel gegensätzliche Positionen gab, die sich in der Darstellung wechselseitig konturieren und präzisieren. Schließlich kommt noch hinzu, dass die unterschiedlichen Auffassungen zu einer Zeit mehr und dann wieder weniger recht behalten haben.
Können See- oder Luftstreitkräfte Kriege allein entscheiden, oder sind sie nur wichtige Unterstützer für die Landstreitkräfte, die den Raum besetzen und dadurch dem Sieg Körper und Gestalt geben? Das ist eine der Fragen, die in Heusers Darstellung der neuzeitlichen Strategiedebatten immer wieder auftaucht und an der sich heftige Kontroversen entzündet haben. Zweifellos hat nicht Admiral Nelson Napoleon besiegt, wiewohl er dessen Flotten bei Abukir und Trafalgar vernichtende Niederlagen bereitet hat, sondern das war zuletzt General Wellington im Verbund mit den Preußen bei Waterloo. Aber Nelsons Seesiege und die dadurch errungene Seeherrschaft der Briten haben ein ums andere Mal Napoleons Siege in großen Landschlachten verpuffen lassen und den Kaiser gezwungen, das nächste militärische Abenteuer zu suchen. Mit dem Russlandfeldzug begann Napoleons Niedergang. Aber Russland hatte Napoleon nur angegriffen, weil er England nicht anders packen konnte. Hatte also doch die Seestrategie der Briten den Ausschlag gegeben?
Was zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Zusammenwirken von Land- und Seemacht war, verschob sich mit dem Beginn des Nuklearzeitalters zugunsten der Luftwaffe: Es waren nicht die Erfolge der amerikanischen Bodentruppen, die Insel für Insel von den Japanern zurückeroberten, sondern die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, die den Tenno zur Kapitulation zwangen. Aber spätestens in Vietnam wurde dann die Doktrin von der kriegsentscheidenden Bedeutung der Luftwaffe noch einmal relativiert, um im Golfkrieg von 1991 wieder aufzuleben. Doch die Probleme, in die das Militär der Vereinigten Staaten im darauffolgenden Irakkrieg geriet, verpassten der Doktrin abermals ein paar tiefe Schrammen.
Offenbar ist entscheidend, gegen wen gekämpft wird, und wenn es sich dabei um Partisanen handelt, die ohne schwere Waffen agieren, verliert die Luftwaffe viel an Kraft. Aber auch das ist, wie Heuser zeigt, eine sich durch die Geschichte des strategischen Denkens hindurchgehende Kontroverse, die zwischen den Vertretern der Historischen Schule und den Anhängern der Materialschule ausgetragen worden ist. Letztere neigen dazu, immer wieder von "Revolutionen" der Kriegführung zu sprechen, die sie mit der Einführung neuer Waffen erklären. Die Historische Schule dagegen nimmt an, dass es zwar zu deutlichen Modifikationen der Strategie kommt, sich nach einiger Zeit aber zeigt, dass keineswegs alle Prinzipien der Kriegführung und des strategischen Gebrauchs militärischer Gewalt revidiert werden müssen, sondern viele weiterhin Bestand haben. So haben sich auch Alfred Nobel und Hieram Maxim getäuscht, als sie mit ihren Erfindungen, dem Dynamit und dem Maschinengewehr, das Ende des Krieges heraufkommen sahen.
Die Lektüre von Heusers Buch legt im Übrigen nahe, die verbindliche Definition des Sieges nicht mehr, wie in der längsten Zeit der hier dargestellten Strategiedebatten, in der Alternative Niederwerfen oder Ermatten zu suchen, die vom späten Clausewitz zum analytischen Schlüssel bei der Durchdringung des Kriegsgeschehens gemacht worden ist, sondern sich eher an der von dem spanischen Philosophen Unamuno aufgeworfenen Alternative zwischen Siegen und Überzeugen zu orientieren, wobei der wirkliche Sieger der ist, der den Verlierer nachhaltig davon überzeugt, dass die Akzeptanz der entstandenen Lage für ihn das Beste ist.
HERFRIED MÜNKLER
Beatrice Heuser: "Den Krieg denken". Die Entwicklung der Strategie seit der Antike. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2010. 523 S., geb., 39,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Was ist ein militärischer Sieg und wie lässt er sich erreichen? Herfried Münkler erfährt es in diesem Buch der Neuzeithistorikerin Beatrice Heuser, das er Berufsmilitärs und auch Politikern gern zu lesen gäbe. Und weil Diskussionen um Strategien gerade wieder heiß ausgefochten werden, erscheint Münkler der Band auch hoch aktuell. Kein Problem für Münkler, wenn die Autorin bei ihrem Gang durch die Archive und bei ihrer historischen Rekonstruktion europäischer Strategieentwürfe von der Antike, vor allem aber, so Münkler von der Französischen Revolution bis heute, nicht allzu sehr auf Eingängigkeit achtet. Vom "Durchkämpfen" handelt der Band ja schließlich auch irgendwo. Heusers militärstrategische Ideengeschichte findet Münkler am stärksten, wenn die Autorin über totale Mobilmachung und Seekriegs-, Luftmacht- und Nuklearstrategien schreibt und kontroverse Standpunkte konkurrieren lässt, zum Beispiel Historische Schule gegen Materialschule.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH