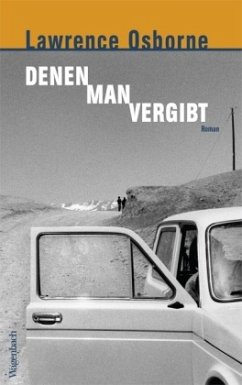In einer träumerischen Landschaft inmitten der Wüste Marokkos veranstalten Richard und Dally für ihre Freunde eine dreitägige extravagante Party im Gatsby- Stil, mit Kokain, Champagner, Pool und Feuerwerk. Auf dem Weg dorthin überfährt das britische Paar David und Jo, angetrunken und heillos zerstritten, einen Fossilienverkäufer am Straßenrand und möchte die Leiche am liebsten verschwinden lassen. Aber da taucht die Familie des Opfers auf und verlangt Davids Anwesenheit bei der Beerdigung in einem abgelegenen Dorf, während Jo sich weiter auf der ausgelassenen Party vergnügt. Die strebt ungebrochen ihrem Höhepunkt zu - unter den argwöhnischen Augen des Hausangestellten Hamid. Lawrence Osborne seziert seine Figuren gnadenlos, ihre Persönlichkeit und ihre Beziehungen, erfindet eindrückliche, filmische Szenen und schwankt in seiner feinen Schreibweise zwischen Zärtlichkeit und Zynismus.

"Denen man vergibt": Lawrence Osborne treibt ein schlaglochgesättigtes Spiel mit der Schuld
Wenn wohlsituierte, gleichwohl emotional abgewirtschaftete Ehepaare eine Reise in die marokkanische Wüste unternehmen, dann überstrahlt unweigerlich und ähnlich gnadenlos wie die Sonne der Name Paul Bowles das Geschehen. Schließlich hat spätestens dieser Autor die Wüste zum Spiegel des sinnentleerten, verkrusteten westlichen Daseins werden lassen, dem man jenseits der Abpolsterung durch den gewohnten Komfort plötzlich schutzlos ausgeliefert ist. Derart auf sich selbst zurückgeworfen aber kann man der inneren Leere gerade hier entkommen - wenn man denn bereit ist, sich ihr auszusetzen.
Zugleich freilich taugt die unendliche Weite, in der selbst die Vegetation verkümmert, zur idealen Spielbühne, auf der die Dekadenz ihren vorläufigen Kulminationspunkt erreicht und die zweckfreie Verschwendung noch einmal umso lustvoller zelebriert werden kann. An der mehrtägigen Party jedenfalls, die Lawrence Osborne in seinem Roman "Denen man vergibt" ein schwules Pärchen auf dem mit allen Schikanen aufpolierten Ksar veranstalten lässt, hätte Jay Gatsby vermutlich ebensolche Freude gehabt wie Jack Kerouac, Truman Capote oder all jene Schriftstellerkollegen, die im Gefolge von Bowles zumindest für eine kurze Zeit den Verlockungen Tangers erlagen.
Der 1958 geborene britische Reisereporter Lawrence Osborne, der bereits eine ganze Reihe von Romanen publiziert hat, bis nun erstmals ein im Original schon 2012 erschienener Titel ins Deutsche übertragen wurde, kennt nicht nur das Terrain, auf dem er sich bewegt, er weiß ganz offensichtlich auch, in welche Tradition er sich begibt. Mehr noch, sein bewusst lässiger, mitunter süffisanter Ton lässt darüber spekulieren, ob das Setting womöglich selbst nur Kulisse sein will, vor deren Hintergrund für ein verlängertes Wochenende nichts Geringeres verhandelt wird als die universale Frage der Schuld.
Bereits als die Eheleute David und Jo Henninger in Tanger aufbrechen, um an der legendären Party von Richard und Dally teilzunehmen, ahnt man, dass Unheilvolles im Gange ist. Er ein dem Alkohol zugetaner Arzt, der seine Trunksucht genauso verdrängt wie die daraus resultierenden Kunstfehler, das Gaspedal immer eine Spur zu tief durchgedrückt, sie eine semi-attraktive, ideen- und erfolglose Kinderbuchautorin, die Karte im Leihwagen veraltet, der Streit, nicht allein über die Route, stets zumindest im Stand-by-Modus.
Als die Hennigers das Anwesen der Freunde schließlich erreichen, liegt ein Toter in ihrem Wagen. David, einige Promille im Blut, hat auf der nächtlichen Reise einen jungen Fossilienverkäufer überfahren. Anstatt am Unfallort zu bleiben und die Polizei zu verständigen, hat er die Papiere des Toten vergraben und würde das am liebsten auch mit der Leiche tun, um keine Scherereien zu haben. Wer interessiert sich schon für einen dieser Wüstenbewohner?
Nicht erst als der Vater des Toten auftaucht und David auffordert, mit ihm gemeinsam den Sohn in dessen Heimatdorf zu überführen und zu bestatten, wird klar, dass die größte Schuld, die Osborne verhandeln lässt, jene des Kolonialismus ist. Während die einen sich das bloße Überleben unter den extremen klimatischen Bedingungen hart erarbeiten müssen, sind die anderen um den Frischegrad von Erdbeer- und Garnelen-Arrangements besorgt. Dass "Denen man vergibt" indes nicht zum politisch korrekten Lehrstück wird, verdankt sich den überraschenden, durchaus krimitauglichen Wendungen, die Osborne seiner Story zu geben weiß. Schlichtes Schwarz und Weiß, Gut und Böse gibt es hier nicht, schuldig machen die Figuren sich alle auf je eigene Weise. Garantie auf Läuterung wird nicht gegeben. Wer jedenfalls ein Faible für rasante, wenngleich rumpelige Fahrten durchs staubtrockene Niemandsland hat, der wird sich bei Osborne gut aufgehoben fühlen.
WIEBKE POROMBKA
Lawrence Osborne:
"Denen man vergibt". Roman.
Aus dem Englischen von Reiner Pfleiderer.
Wagenbach Verlag, Berlin 2017. 272 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main