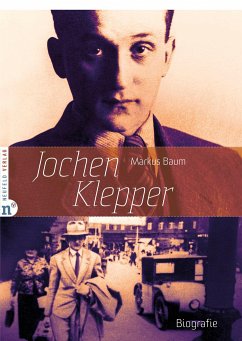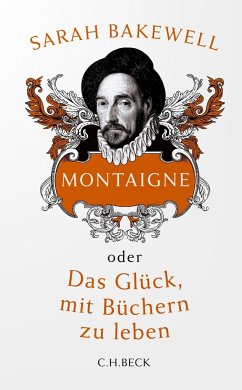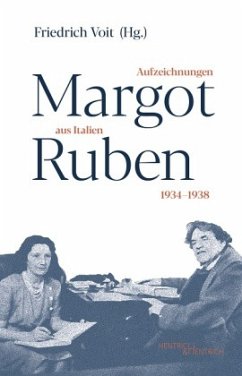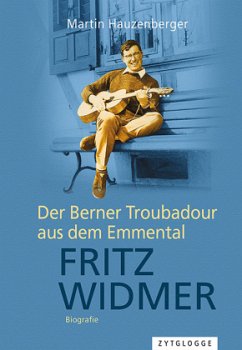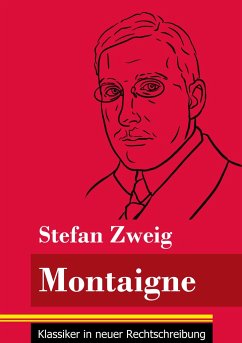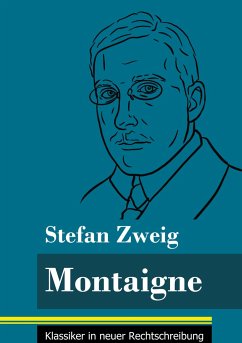Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug
Erinnerungen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Angst vor den Bomben, eine Kindheit im Krieg - damit beginnen Helmut Lethens Erinnerungen, die durch mehr als sieben Jahrzehnte bundesdeutscher Geschichte führen: der Schock, als er mit achtzehn Jahren in Alain Resnais' Film «Nacht und Nebel» zum ersten Mal mit dem Holocaust konfrontiert ist. Das Gefühl der Befreiung, als er vom biederen Bonn in das viel liberalere Amsterdam zieht, um dort zu studieren. Schließlich das von Aufruhr und Protest aufgewühlte Berlin: Hier demonstriert Lethen 1967 gegen den Besuch des Schahs, und bald agitiert er als Sprecher der Kampagne für ein Kinderkr...
Die Angst vor den Bomben, eine Kindheit im Krieg - damit beginnen Helmut Lethens Erinnerungen, die durch mehr als sieben Jahrzehnte bundesdeutscher Geschichte führen: der Schock, als er mit achtzehn Jahren in Alain Resnais' Film «Nacht und Nebel» zum ersten Mal mit dem Holocaust konfrontiert ist. Das Gefühl der Befreiung, als er vom biederen Bonn in das viel liberalere Amsterdam zieht, um dort zu studieren. Schließlich das von Aufruhr und Protest aufgewühlte Berlin: Hier demonstriert Lethen 1967 gegen den Besuch des Schahs, und bald agitiert er als Sprecher der Kampagne für ein Kinderkrankenhaus in Kreuzberg an vorderster Front. Die maoistische K-Gruppe schließt Lethen wegen «Versöhnlertums» aus, dennoch trifft ihn der «Radikalenerlass», das Berufsverbot in Deutschland - das sich als unfreiwillige Chance erweist: In den Niederlanden schreibt Lethen die «Verhaltenslehren der Kälte», in denen er das Verhältnis von Geist und Politik im 20. Jahrhundert auf ganz neue und bis heuteaktuelle Weise ausgeleuchtet hat.
Helmut Lethen berichtet in seiner Autobiographie, was ihn geprägt hat: von politischen und denkerischen Experimenten, von Weggefährten sowie Ideengebern wie Adorno und Enzensberger. Ein Entwicklungsroman der Bundesrepublik - wie ihn nur noch wenige Intellektuelle zu erzählen vermögen.
Helmut Lethen berichtet in seiner Autobiographie, was ihn geprägt hat: von politischen und denkerischen Experimenten, von Weggefährten sowie Ideengebern wie Adorno und Enzensberger. Ein Entwicklungsroman der Bundesrepublik - wie ihn nur noch wenige Intellektuelle zu erzählen vermögen.