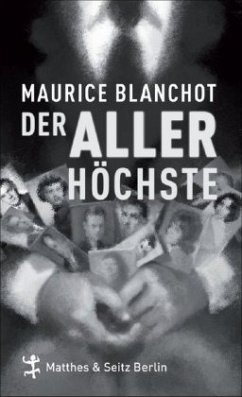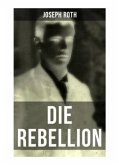Henri Sorge, gerade erst von einer Krankheit genesen, kehrt in seine Wohnung in einem Mietshaus zurück, das in eine Art Spital umgewandelt worden ist. Wahnvorstellungen bemächtigen sich seiner, die Beziehung zu seinen Mitmenschen wechselt zwischen Abscheu und Hörigkeit, Abhängigkeit und Abstoßung, Größenwahn und Minderwertigkeitsgefühlen. Unentwegt stellt sich Sorge Fragen über die eigene Existenz, gibt seiner Bewunderung der Welt und des sie regierenden Gesetzes Ausdruck. Ständig widerspricht er sich dabei selbst oder negiert das Gesagte.

Maurice Blanchot ist der Vater der postmodernen Literaturtheorie. Auch die deutsche Erstübersetzung seines 1948 entstandenen Romans "Der Allerhöchste" ist eine literarische Versuchsanordnung.
Weil sein Werk lange schon das Gesicht seines Autors ausgelöscht habe, entgegnete Maurice Blanchot einmal seinem Verleger, könne er ihm leider keine Fotografie von sich zur Verfügung stellen. Im Jahr 2003 ist der vermutlich radikalste unter den französischen Philosophenschriftstellern fünfundneunzigjährig gestorben. Zuletzt wurde er im Mai 1968 auf einer Studentendemonstration gesichtet und fotografiert. Seitdem existierten weder Bilder noch Geschichten aus dem Privatleben dieses diskret engagierten Intellektuellen, dessen Schreiben nach einer beinah tödlichen Begegnung mit den deutschen Besatzern im Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen dem Sterben gewidmet war - dem Sterben mit literarischen Mitteln.
Nicht umsonst haben sich die Denker der Dekonstruktion, unter ihnen Michel Foucault, Jacques Derrida und Pierre Klossowski, an Blanchots Todespoetik abgearbeitet. In seinem essayistischen, noch mehr aber in seinem erzählerischen Werk sahen sie genau jene Kraft, jene trügerische différance am Werk, die später den "Tod des Autors" besiegeln sollte.
Fast alle Sentenzen der postmodernen Literaturtheorie gehen auf eine Auseinandersetzung mit den Werken Maurice Blanchots zurück. Von Wahrheiten, die sich im Sprechakt verbergen, ist dort die Rede, vom Wortsinn, der sich entzieht oder verflüchtigt. Den Topos vom Primat des Bedeutenden über das Bedeutete, des Werdens über das Sein hat Blanchot mustergültig vorweggenommen: Das Finden der Wahrheit wird darin durch den Akt des Suchens ersetzt.
In dieser Unabschließbarkeit liegt der Reiz dieser widerborstigen Lektüre. Wer sich jedoch nicht einlassen mag auf diese Treibjagd des Sinns, dem wird Blanchots Wüten gegen die Konventionen der rationalen Erkenntnis bald unendlich mühsam vorkommen. Wer es genießen will, muss sich auf das Abenteuer einer spekulativen Lektüre einlassen.
In diesem Sinne hat man es auch bei der ersten deutschen Übersetzung des im Jahr 1948 im französischen Original erschienenen Romans "Der Allerhöchste", auf Französisch "Le Très-Haut", mit einer experimentellen Situation zu tun. Schriftsteller, Erzähler und Leser befinden sich in ihrer existentiellen Orientierungslosigkeit auf Augenhöhe. Kein auktorialer Rädelsführer dirigiert das Geschehen, und kein souveräner Rezipient zieht daraus seine voreiligen Schlüsse. Und welche Schlüsse wären aus diesem Roman auch schon zu ziehen?
Henri Sorge ist ein braver Standesbeamter, der das Gesetz achtet und seine Pflichten klaglos erfüllt. "Ich war nicht allein, ich war ein beliebiger Mensch. Wie sollte ich diese Formel je vergessen?" Mit dieser Selbstaussage verkörpert Sorge genau jenen sozialen Typus, der von Albert Camus über Georges Perec bis zu Michel Houellebecq längst zum Inventar der französischen Literaturgeschichte gehört. Immer wieder ist das Scheitern des kleinen Angestellten an einem technokratischen und deshalb menschenunwürdigen System beschrieben und beklagt worden.
Existenzphilosophische Fragen zur Rolle des Einzelnen in einem totalitären Ganzen gehören zum literarischen Odeur der späten vierziger Jahre. Im Jahr 1947 erscheint "Die Pest" von Albert Camus. Eine Epidemie, die sich unschwer als Metapher für die damals aktuellen ideologischen Verheerungen in Europa entschlüsseln lässt, stellt die Solidarität zwischen den Menschen auf eine harte Probe. Ein Jahr später ist auch in Maurice Blanchots Text von einer Epidemie die Rede. Henri Sorge hat sich wohl angesteckt oder ist gar die Quelle einer mysteriösen Seuche.
Sein Wohnhaus wird in eine Krankenstation umfunktioniert. Die staatliche Aufsicht verhängt Ausgangssperren. Revolutionäre proben indes den Aufstand und versuchen den Erzähler auf ihre Seite zu ziehen. Oft redet Sorge im Fieber, wahnhafte Bilder wechseln sich mit mythologischen, an die Orestie gemahnenden Familienaufstellungen ab. Blanchot arbeitet mit Ellipsen, rasanten Perspektivwechseln und Paradoxien. "Begreifen Sie doch: Alles, was von mir kommt, ist für Sie nichts als Lüge, denn ich bin die Wahrheit." So stellt man sich keinen konsistenten Charakter vor, aber genau jene Persönlichkeitsspaltung entspricht Maurice Blanchots poetologischem Entselbstungsprogramm.
"Was ist los mit Ihnen?", wird Sorge von seinem Vorgesetzten einmal gefragt. "Das ist ja die reinste Philosophie." Ja, "Der Allerhöchste" ist die reinste Philosophie oder zumindest ihre literarische Probe aufs Exempel. Der Text vereint Sprach-, Metaphysik- und Totalitarismuskritik vor narrativer Folie. Die Figuren sind nie ganz bei sich selbst, ihre Aussagen sind im Wortsinn verrückt und wirken deshalb auf den Leser verstörend. Gerade weil der Wahn sich im Laufe des Romans immer unaufhaltsamer Bahn bricht und in einer, wie die Übersetzerin Nathalie Mälzer-Semlinger in ihrem instruktiven Nachwort schreibt, "langage fou" gipfelt, gerät die Lektüre bald selbst zu einer intellektuellen Wahnsinnstat. Blanchots Gewährsmänner sind die großen Metaromanciers Kafka und Beckett.
"Der Allerhöchste" ist aber kein Repräsentant einer wie auch immer zu definierenden avantgardistischen Gattung, er hat seine eigene begründet. Damit zielt Blanchot auf etwas, das man Metaphysik des künstlerischen Nullpunkts nennen könnte. Die "Reinheit" der Sprachkunst, die sich um keinen Preis mimetisch geriert, wird einer "kranken" abbildhaften Belletristik gegenübergestellt. In seinen vor drei Jahren in Deutschland veröffentlichten Essays aus den Jahren 1941 bis 1944 führt Maurice Blanchot dieses ästhetische Konzept aus. "Das Journal des débats" erschien unter den Fittichen des Général Pétain, und damit schließt sich der künstlerisch-politische Kreis um den einstigen Résistance-Kämpfer. Zwar hat Blanchot rechtzeitig von seinen faschistischen Neigungen Abstand genommen und eine vorbildliche Karriere als engagierter Linksintellektueller eingeschlagen, dennoch lassen seine von der Dekonstruktion vereinnahmten Überzeugungen einen Hang zum erkenntnistheoretischen Urschlamm erkennen.
Ein Autor, der auf ein Publikum hin schreibe, behauptete Blanchot einmal, schreibe in Wahrheit nicht. "Daher die Bedeutungslosigkeit von Werken, die geschrieben wurden, um gelesen zu werden." Ist ein Leser, der den Ideen seines Autors versucht zu folgen, damit ein schlechter, am Ende sogar ein falscher Leser? Die erste Übersetzung von Maurice Blanchots drittem und letztem Roman gibt uns jetzt Gelegenheit, diese Fragen aus kritischer Distanz zu beantworten.
KATHARINA TEUTSCH
Maurice Blanchot: "Der Allerhöchste".
Aus dem Französischen von Nathalie Mälzer-Semlinger. Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2011. 408 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Ein richtige Leserim im Falschen möchte Katharina Teutsch sein, muss sie sein, um Maurice Blanchots letzten Roman mit seiner erkentnistheoretischen Wühligkeit überhaupt lesen zu können. Dass der "Philosphenschriftsteller" Blanchot mit der Figur des kleinen Angestellten in existentieller Not in einer Traditionslinie mit Camus, Perec und Houellebecq steht, hilft Teutsch nämlich auch nicht weiter. Eher schon vermag eine spekulative Lektürehaltung Teutsch weiterzuhelfen und die Ahnung, dass dieser Text nicht das Finden der Wahrheit propagiert, sondern die Suche nach ihr. Für Teutsch ist das Buch darum alles andere als eine Erzählung, es ist "reinste Philosophie", Sprach- und Metaphysikkritik, den Figuren in den Mund gelegt, und zum Glück, wie Teutsch zu finden scheint, mit einem brauchbaren Nachwort versehen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH