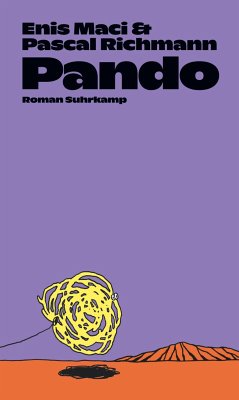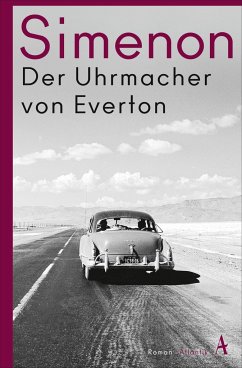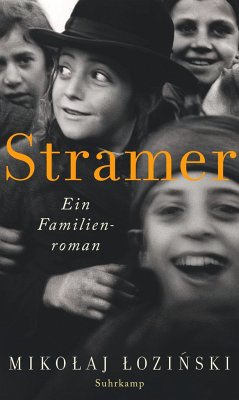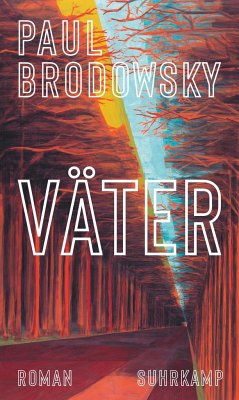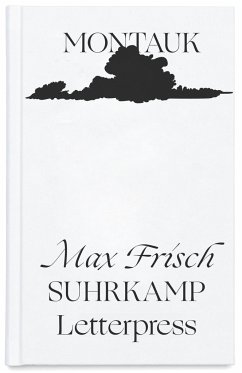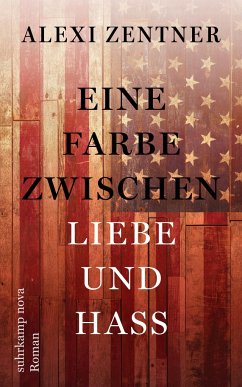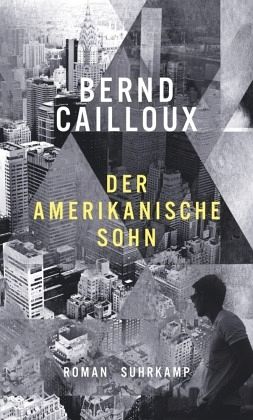
Der amerikanische Sohn
Roman

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Und du? Hast du Kinder? - Ja, einen Sohn, in Amerika. Danach Schweigen. Die am Rande einer Podiumsveranstaltung arglos gestellte Frage rührt an ein Lebenstrauma. Von seiner Vaterschaft erfuhr der Altachtundsechziger vor dreißig Jahren per Zufall auf der Tanzfläche. Der Junge namens Eno wuchs in Jamaika auf, später in den USA, Kontakt gab es keinen. Die Mutter, eine Hamburgerin, ging eigene Wege. Und so hatte die Existenz des Sohns den Vater, der als Aktivist und Hippie-Businessman von Familie nicht viel wissen wollte, bisher nie wirklich gekümmert. Doch 2014 lädt ihn eine Stiftung nach N...
Und du? Hast du Kinder? - Ja, einen Sohn, in Amerika. Danach Schweigen. Die am Rande einer Podiumsveranstaltung arglos gestellte Frage rührt an ein Lebenstrauma. Von seiner Vaterschaft erfuhr der Altachtundsechziger vor dreißig Jahren per Zufall auf der Tanzfläche. Der Junge namens Eno wuchs in Jamaika auf, später in den USA, Kontakt gab es keinen. Die Mutter, eine Hamburgerin, ging eigene Wege. Und so hatte die Existenz des Sohns den Vater, der als Aktivist und Hippie-Businessman von Familie nicht viel wissen wollte, bisher nie wirklich gekümmert. Doch 2014 lädt ihn eine Stiftung nach New York ein. Eine Chance, mit der verdrängten Geschichte ins Reine zu kommen. Je mehr er in die Stadt eintaucht, an alten und neuen Orten den Spuren des Undergrounds der Siebziger bis zu den Vorzeichen der Präsidentschaft Donald Trumps folgt, umso mehr gewinnt die Frage nach dem nahen fernen, längst erwachsenen Kind an Dringlichkeit.
Selbstironisch und mit warmer Lakonie geht Bernd Cailloux aufdie Suche nach dem verlorenen Sohn, auf einen USA-Trip in die eigene Vergangenheit und fremde Gegenwart - als New-York-Flaneur zu Fuß, zögerlich im Internet und zuletzt im Flugzeug Richtung Menlo Park, ans westliche Ende der westlichen Welt.
Selbstironisch und mit warmer Lakonie geht Bernd Cailloux aufdie Suche nach dem verlorenen Sohn, auf einen USA-Trip in die eigene Vergangenheit und fremde Gegenwart - als New-York-Flaneur zu Fuß, zögerlich im Internet und zuletzt im Flugzeug Richtung Menlo Park, ans westliche Ende der westlichen Welt.