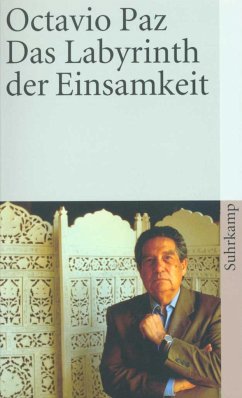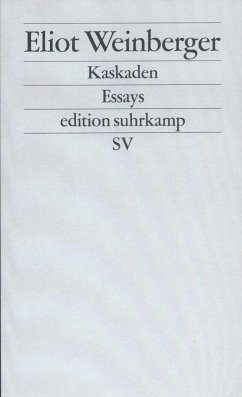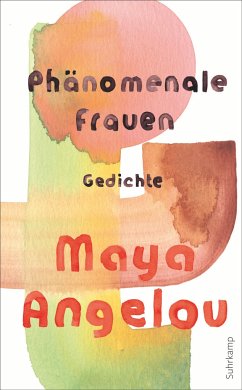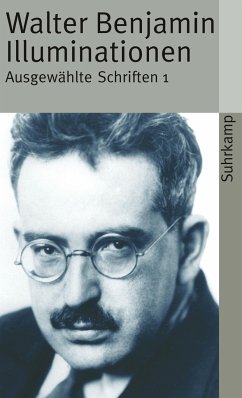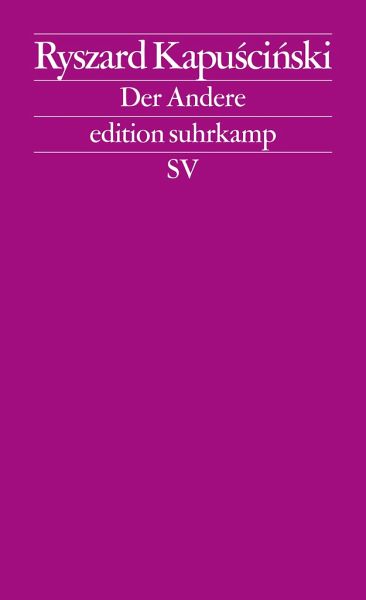
Der Andere
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
12,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Als »besten Reporter der Welt« würdigte Spiegel online Ryszard Kapuscinski nach seinem Tod im Januar 2007. Seine Bücher wie König der Könige und Meine Reisen mit Herodot gehören inzwischen zum Kanon der Weltliteratur. Die Vorlesungen, die Kapuscinski im Jahr 2004 am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen hielt, waren noch einmal seinem großen Thema gewidmet: der Begegnung mit dem Anderen. Kapuscinski erläutert, welche Bedeutung dieser Begriff Emmanuel Lévinas' für seine Arbeit hatte und erfüllt die philosophische Kategorie anhand seiner Erfahrungen als Reisender, Jour...
Als »besten Reporter der Welt« würdigte Spiegel online Ryszard Kapuscinski nach seinem Tod im Januar 2007. Seine Bücher wie König der Könige und Meine Reisen mit Herodot gehören inzwischen zum Kanon der Weltliteratur. Die Vorlesungen, die Kapuscinski im Jahr 2004 am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen hielt, waren noch einmal seinem großen Thema gewidmet: der Begegnung mit dem Anderen. Kapuscinski erläutert, welche Bedeutung dieser Begriff Emmanuel Lévinas' für seine Arbeit hatte und erfüllt die philosophische Kategorie anhand seiner Erfahrungen als Reisender, Journalist und Publizist mit Leben. Das Vermächtnis eines großen kosmopolitischen Intellektuellen.