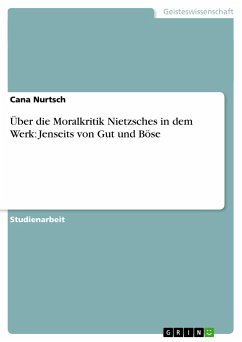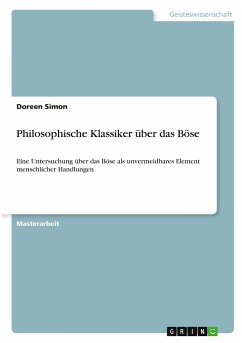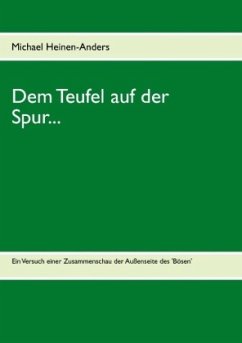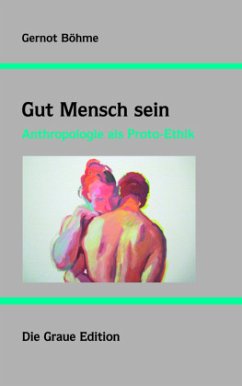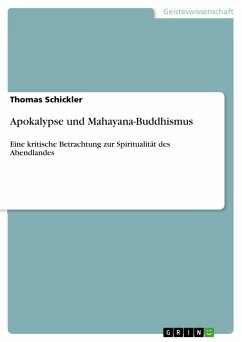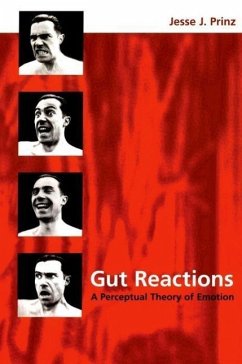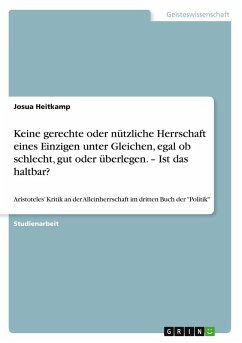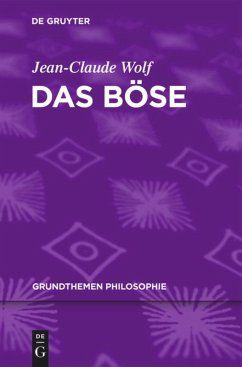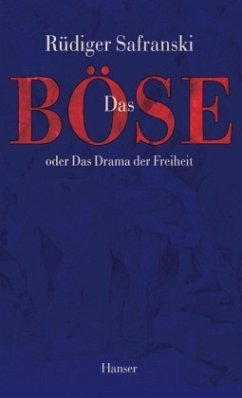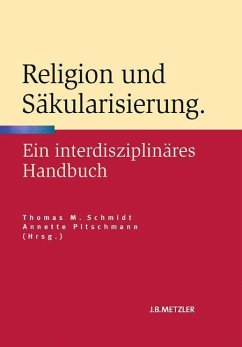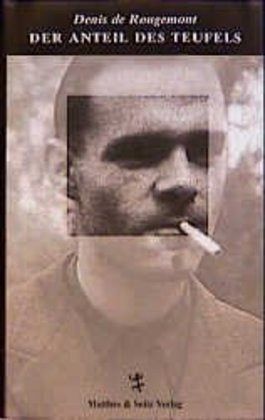
Der Anteil des Teufels
Aus d. Französ. v. Josef Ziwutschka u. Elena Kapralik
Mitarbeit: Ceronetti, Guido;Übersetzung: Ziwutschka, Josef; Kapralik, Elena
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
24,80 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Gut und Böse"Ich zeigte, wie der Teufel in unseren Schöpfungen - das ist der Anteil des "Geistes der stets verneint" und ohne den wir wie Affen wären - am Werk ist, aber auch in der Entschaffung, der zunehmenden Herrschaft der Zwangsläufigkeiten nur unserer kraftlosen Freiheiten wegen."
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.