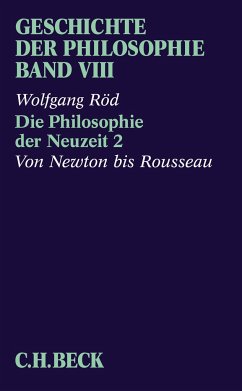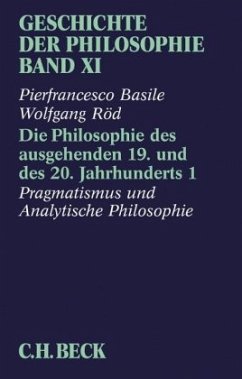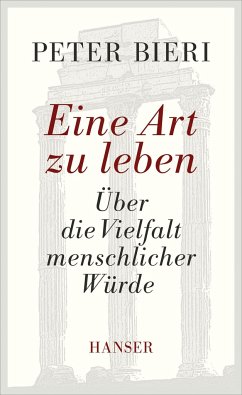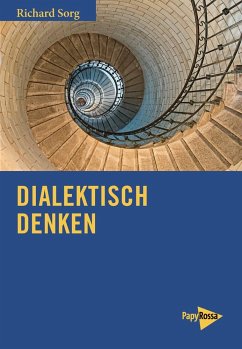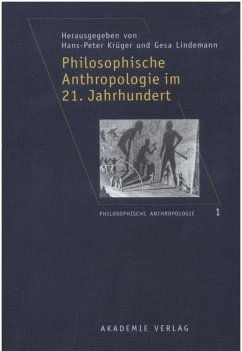Nicht lieferbar

Der aufrechte Gang
Eine Geschichte des anthropologischen Denkens. Ausgezeichnet mit dem Tractatus, Essaypreis des Philosophicum Lech 2013
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Dass wir auf zwei Beinen gehen, halten wir für selbstverständlich, und doch ist der Mensch eines der ganz wenigen Lebewesen, die dazu in der Lage sind. In seinem glänzend geschriebenen Opus Magnum führt Kurt Bayertz den Leser zu nichts weniger als der Frage, was Menschsein bedeutet. Was macht den Menschen zum Menschen? Was erhebt ihn - im wahrsten Sinne des Wortes - über alle anderen Lebewesen? Was beschert ihm seine Sonderstellung, Hochmut und Rückenprobleme inklusive? Bayertz hat das Denkmotiv des "aufrechten Ganges" durch zweieinhalbtausend Jahre Geistesgeschichte verfolgt, von Ovid, ...
Dass wir auf zwei Beinen gehen, halten wir für selbstverständlich, und doch ist der Mensch eines der ganz wenigen Lebewesen, die dazu in der Lage sind. In seinem glänzend geschriebenen Opus Magnum führt Kurt Bayertz den Leser zu nichts weniger als der Frage, was Menschsein bedeutet. Was macht den Menschen zum Menschen? Was erhebt ihn - im wahrsten Sinne des Wortes - über alle anderen Lebewesen? Was beschert ihm seine Sonderstellung, Hochmut und Rückenprobleme inklusive? Bayertz hat das Denkmotiv des "aufrechten Ganges" durch zweieinhalbtausend Jahre Geistesgeschichte verfolgt, von Ovid, in dessen Schöpfungsgeschichte der "rohe, ausdruckslose Erdenkloß" durch seine Aufrichtung erst menschlich wird, über die "aufrecht kriechenden Maschinen" bei La Mettrie, die trotz all ihrer Bemühungen stets "nur Tiere" bleiben, bis hin zum Appell an den "aufrechten Gang" im November 1989 in der DDR. Die Körperhaltung bestimmt stark das menschliche Selbstbild und findet in der Politik bis heute ihren Ausdruck im "aufrechten" Menschen als Metapher und Symbol für ein würdiges Leben.