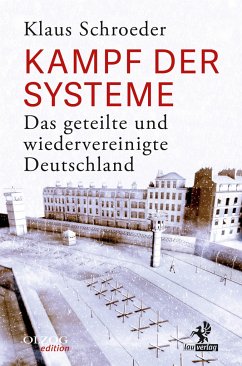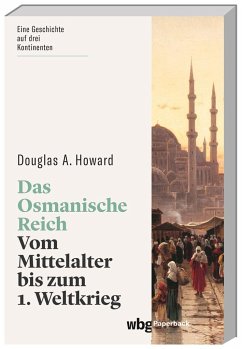Der Aufstieg der Manager
Wertewandel in den Führungsetagen der westdeutschen Wirtschaft, 1949-1989
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
44,95 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Manager auch in der Bundesrepublik zur prägenden Figur moderner Unternehmen. Bernhard Dietz erklärt diesen Aufstieg der Manager und setzt ihn in Beziehung zu sich wandelnden Idealen und Leitbildern. Indem er untersucht, wie sich "Arbeit", "Leistung" und "Führung" zwischen Nationalsozialismus und Neoliberalismus veränderten, leistet er einen ganz neuen Beitrag zu einer Kulturgeschichte des Kapitalismus.