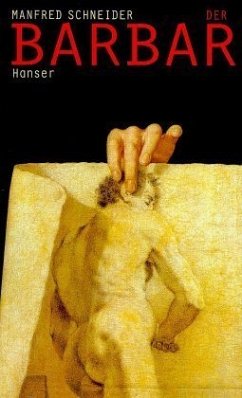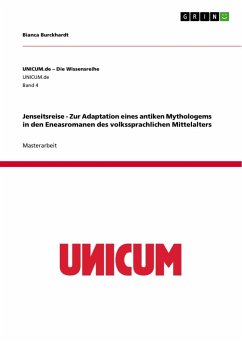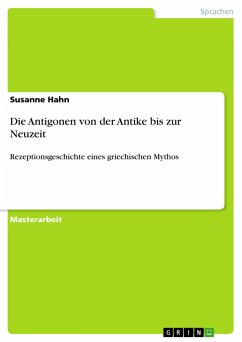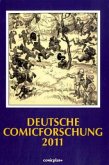Barbarisch werden heute die Hooligans, Punks oder Skinheads genannt. Die alten Griechen bezeichneten den Rest der Welt außerhalb ihrer Kultur so, Jesus wurde von Römern und Urchristen Barbar genannt. Luther sprach so von sich, und Hitler rühmte sich, der neue Barbar zu sein. Manfred Schneider ist es gelungen, den Barbaren als Grundfigur der menschlichen Befindlichkeit ans Licht zu bringen. Überraschend und faszinierend wird sichtbar, welch starke Rolle das Bild vom Barbaren in uns spielt: als ersehnter Heros des Neuen, als verführerischer Umstürzler oder als Befreier aus vermeintlicher Ausweglosigkeit.

Manfred Schneider singt dem Barbar ein rauhes Lied / Von Hartmut Böhme
Kann man, wenn alle historischen Quellen bekannt und erforscht sind, ein Buch schreiben, das dennoch neu ist, dem Bekannten Überraschendes abgewinnt und am Ende den Eindruck zurückläßt, daß man auf dieses Buch schon lange gewartet hat, ohne es gewußt zu haben? - Man kann. Manfred Schneider hat es vorgemacht.
Wie ist das möglich? Es hat viel mit dem Zustand der Wissenschaften zu tun. Man liest von Soziologen etwas über Skins und Jugendgewalt, von Historikern über das Ende Roms im Ansturm barbarischer Völker aus dem Norden. Kunsthistoriker erforschen die Geschichte des Bildersturms, der als wiederkehrender Kunstvandalismus (uns Bildungsbürger) ebenso abstößt wie das seit der Renaissance stereotype, auf Tacitus zurückgehende Lob der jugendfrischen Germanen, denen seit Kleists "Hermannsschlacht" eine Erneuerung der Welt aus dem Blut ihrer Opfer zugesprochen wird.
Christliche Alttestamentler erklären in seltsamer Eintracht mit jüdischen Thora-Gelehrten, daß Moses, wenn er, vom Berg Sinai mit den Gesetzestafeln des Einen Gottes zurückkehrend, gegen seine ums Goldene Kalb tanzenden Volksgenossen wütet, einen Barbarismus überwinde und damit zum Stifter einer "Hoch"-Religion werde - während die Tanzenden "primitiv" seien. Altphilologen haben die Dichotomie von Griechen und Barbaren (das ist der Rest der Welt) vielfach erklärt. Kirchengeschichtler untersuchten den Primitivismus millenaristischer Bewegungen. Kulturhistoriker haben den Wechsel vom "guten" zum "bösen" Wilden in den Imagologien der europäischen Kulturen dargestellt. Ethnologen studieren, wie durch Stigmatisierung von inneren oder äußeren "Barbaren" soziale Ordnung gebildet wird.
Der Barbar, so scheint es, ist immer schon da - wie das bucklicht Männlein im Kindervers. Wir wissen viel davon. Doch die Arbeitsteilung in den Wissenschaften und die rhetorische Ausbeutung des "Barbaren" in Medien und Politik verhindern, daß dieses Wissen bewußt wird. Das zuerst lernt man bei Schneider: Der "Barbar" ist uns nur allzu vertraut, doch wir sollen nicht eigentlich etwas wissen von ihm. Er soll funktionieren - als Bannkraft im Imaginären.
Die in Einzelprobleme verhedderten Wissenschaften haben versäumt, uns Einsichten zu vermitteln darüber, daß der Barbar seit 2500 Jahren eine grundlegende Figur ist. Der "Barbar" hat sich allem, den Hoffnungen auf Erneuerung, den Ängsten vor Gewalt, den höchsten Errungenschaften wie den tiefsten Erniedrigungen, den kristallinen Ordnungen und den schrecklichen Anomien wie ein Schatten, ja, wie eine Bedingung ex negativo, wie ein verdrehter Doppelgänger angeheftet - unzerstörbar, weil der Barbar, so leibhaftig er sein mag, im letzten ein Immaterielles ist, ein Phantasma, eine Figur, die in nahezu jede Maske, jede Position, jeden Ort der kulturellen Ordnung fahren kann wie ein Dämon.
Es bedurfte also eines Wissenschaftlers, der gegenwartsorientiert denkt, aber dennoch genug von der Wiederholung des Uralten im Allerneusten versteht; der ein Experte hier und ein Laie dort ist, aber weiß, daß erst beides zusammen dazu befähigt, in einem Buch zweieinhalb Jahrtausende Revue passieren zu lassen; der also einerseits die longue durée der Geschichte ebenso ernst nimmt wie andererseits das mikrologische Detail; der dekonstruktivistisch, mentalitätsgeschichtlich, soziologisch, historisch und diskursanalytisch zugleich argumentiert, ohne dabei eklektizistisch zu sein. Kurz: Schneiders Buch ist ein geglückter Fall von Interdisziplinarität. Wenn allenthalben die Erneuerung der Geisteswissenschaften gefordert wird: Hier hat man sie.
Es muß also Manfred Schneider uns die Augen öffnen, die so viel gesehen haben, so wissend sind und doch so blind. Gewalt und Gewalttäter in Geschichte und Gegenwart, wilde Propheten, ungehobelte Häretiker, wüste Schwärmer, stolze Vergewaltiger, fromme Tyrannen, blonde Bestien, brutale Erlöser, messianische Mörder, blutige Wohltäter, schöne Schergen, nicht zu nennen die gesetzlosen Diktatoren, Horden und Heroen - eine endlose Reihe davon zieht ihre Blutspur durchs allzu wirkliche Europa; und unabsehbar ist die Zahl derer, die das Kopfkino der Geschichte bevölkern, berauscht vom Doppelpaß aus Tremendum und Faszinosum, aus Schreck und Verführung, die seit jeher die Gewalt so anziehend machen - in wessen Namen auch immer.
Schneider beginnt mit der griechischen Kultur, in der Kultur und Barbarei noch den schlichten Gegensatz von "zugehörig, gastfreundlich, gesetzlich, gebildet, hochwertig" versus "fremd, feindlich, ungesetzlich, roh, wertlos" bildeten. Doch schon hier - so zeigt Schneider an Polyphem, Antigone, Sokrates - schlägt der interkulturelle Gegensatz in eine intrakulturelle Dialektik um. Der gesetzlose Hüne Polyphem kann noch als Barbar ausgegrenzt und getötet werden. In Sophopkles' "Antigone" ist bereits die Frage virulent, ob die Instanz des Rechts verbrecherisch ist, doch die Gesetzesbrecherin gerecht. Und der satyrhafte Sokrates polemisiert im Namen des Guten und Gerechten gegen die kultivierte Verdrehung der Sprache, gegen sittenlose Elegants, gegen die Noblesse ungerechter Staatslenker.
Das Römische Reich, durch die Kopie der griechischen Kultur entbarbarisiert, sah sich den barbarischen Christen und nordischen Horden aus Überzivilisiertheit verfallen. Rom erfuhr seine Wiedergeburt in seinen primitiven Gegnern: Roma aeterna ist für Schneider das Modell historischer Erneuerungen, von Umwälzungen und Apokalypsen bis hin zur Französischen Revolution, wenn nicht bis zum italienischen Faschismus. In der deutschen Kultur verfolgt Schneider die Aufsteigerlegende des barbarischen Germanen zum Welterlöser.
Er zeigt den Zusammenhang von Reformation und Primitivismus, betrachtet die alte, immer neue Polemik gegen rhetorische Eleganz und Polysemie zugunsten barbarischer Eindeutigkeit und rauher Stimme sowie die Sehnsucht nach dem Vergessen angesichts all der überfüllten Wissensspeicher: Das in Rausch und Blut ertränkte Erinnern soll frei machen für den utopischen Nullpunkt, den Neubeginn aus barbarischer Frühe. Weg Bilder, weg Schriften, weg Bildung, weg Gesetz, weg Wissen! Nietzsches Schwärmen, Jüngers Rausch: Schneider erkennt darin uralte Melodien aus rauher Kehle, die heute ins Grölen herkunftsvergessener Streetgangs übergehen oder in den sanften Barbarismus der Öko-Jünger. Immer wieder erwarten die Menschen den Barbar wie den Messias und fürchten sein Ankommen wie das Ende der Welt.
Von Schneiders Buch wird mehr haben, wer nicht lesen will, was nicht drin steht, und nicht übelnimmt, was problematisch ist oder ärgerlich. Problematisch: Die einzige Frau, die vorkommt, Antigone, gibt weder die Idee ein, auch nach Barbarinnen (Medea, Medusa, die Amazonen, die Danaiden und Bakchen - um nur an antike zu erinnern) zu suchen, noch inspiriert sie Schneider dazu, nach der Gender-Struktur der Phantasmen vom Barbaren zu fragen. Julia Kristeva beginnt genau damit. Kann man die Zehntausende "Barbarinnen" vergessen, die als Hexen gefoltert und verbrannt wurden?
Zu den religiösen Barbaren, schon zu altisraelitischer Zeit, gehören die Propheten, zu christlicher Zeit gab es die Eremiten und Märtyrer. Fast nichts erfährt man über die Ketzerbewegungen des Mittelalters. Kaum belichtet werden die Rassen-Anthropologie seit dem achtzehnten Jahrhundert und der Nazismus. Adornos Wort von der Unmöglichkeit des Gedichts nach Auschwitz wird als eine andere Form des Bilderverbots einsortiert in die Geschichte des Ikonoklasmus. Ändert aber Auschwitz nichts in der Geschichte des "Barbaren"? Kann man aus der Geschichte des Christentums und der Deutschen das Verhältnis zur jüdischen Religion und Kultur auslassen, wenn es um das Barbarische geht? Und wie ist es mit dem Barbarischen in der ästhetischen Moderne von der Jahrhundertwende bis zum späten Handke: Ist es weniger wichtig als Hooligans, Skins, Punks? Hat der Jazz keine Erwähnung verdient? Gibt es keinen Barbarismus in der Wissenschaft (ein großes Thema)?
Man verstehe recht: Bei einem so gewaltigen Thema tut Begrenzung not. Erst sie läßt assoziieren, was es sonst noch gibt. Oft hält man die Einfälle, die ein Buch eingibt, diesem als Kritik vor, statt zu begreifen, daß ein Buch auch deswegen gut ist, weil es über sich hinaustreibt. In diesem Sinn ein letztes Bedenken: Es gibt bei Schneider ein unerörtertes Verhältnis von Geschichtlichkeit und überhistorischem Wesen "des Barbaren". Werden zunächst Linien des Barbarismus-Stereotyps entwickelt, so dominiert später der Eindruck, daß Schneider weder einen historischen Prozeß noch ein strukturell-funktionales Modell verfolgt noch einen obsessiven Diskurs dekonstruiert, sondern einen zeitlosen Archetyp annimmt, der zumindest für die europäischen Kulturen universal ist. Vielleicht stimmt das ja; doch dies wäre an den Quellen zu zeigen und in Abwägung zu den anderen Deutungsoptionen zu diskutieren.
Manfred Schneider: "Der Barbar". Genealogie der Endzeitstimmungen. Hanser Verlag, München 1997. 344 S., geb., 45,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main