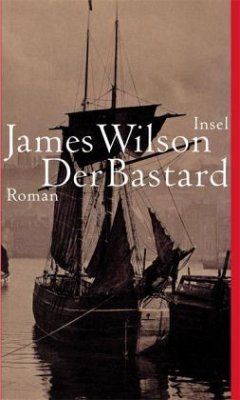Als Ned Gudgeon mit schwerem Kopf in einer Gefängniszelle erwacht, hat er die vergangenen zwei Jahre seines Lebens fast vergessen und weiß auch nicht, warum er eingesperrt wurde. Unsichtbare Kerkermeister versorgen ihn mit dem Nötigsten; der einzige Luxus, so scheint es, sind Papier und Tinte, und nach einiger Zeit, als sein Erinnerungsvermögen langsam zurückkehrt, beginnt Ned, seine Geschichte aufzuschreiben: Im Jahr 1774 war er von Bristol aus nach Amerika aufgebrochen, mit dem Auftrag, den unehelichen Sohn seines Bruders aufzuspüren. Dieser, ein erfolgreicher Unternehmer, hatte dort einst die Mutter seines Kindes im Stich gelassen; nun, am Ende des Lebens, will er den "Bastard" als Erben einsetzen.
Bei der abenteuerlichen Suche nach dem verlorenen Neffen gerät Ned Gudgeon mitten in den Freiheitskampf der Kolonien, die sich gegen die englische Krone auflehnen. Auch der Leser wird unmittelbar in die amerikanische Geschichte hineingezogen - und zugleich in die Geheimnisse einer Familiengeschichte. Denn unverrichteter Dinge zurückgekehrt, setzt Ned die Suche in seiner Heimat fort. Dort will ihn niemand wiedererkennen, und er wird als Betrüger, der sich ein Vermögen aneignen will, verfolgt. Er beginnt zu ahnen, daß der gesuchte Neffe längst zu einer bedrohlichen Figur in seinem Leben geworden ist.
Bei der abenteuerlichen Suche nach dem verlorenen Neffen gerät Ned Gudgeon mitten in den Freiheitskampf der Kolonien, die sich gegen die englische Krone auflehnen. Auch der Leser wird unmittelbar in die amerikanische Geschichte hineingezogen - und zugleich in die Geheimnisse einer Familiengeschichte. Denn unverrichteter Dinge zurückgekehrt, setzt Ned die Suche in seiner Heimat fort. Dort will ihn niemand wiedererkennen, und er wird als Betrüger, der sich ein Vermögen aneignen will, verfolgt. Er beginnt zu ahnen, daß der gesuchte Neffe längst zu einer bedrohlichen Figur in seinem Leben geworden ist.

Wilder Westen: James Wilson trägt Reisekleider in Übergröße
Der Mann wacht in einer Gefängniszelle auf und erinnert sich an nichts. Als erstes kommt sein Name wieder - Ned Gudgeon. Dann Bruchstücke, ein Schlag, eine Überwältigung. Er findet Papier und Tinte, wähnt sich, obwohl er allein ist, beobachtet. Er schreibt auf, wie er sein Bewußtsein verloren hat. Der Schlag stand am Ende einer langen Reise, die Ned Gudgeon, der nicht mehr ganz junge englische Edelmann, 1774 in die amerikanischen Kolonien gemacht hat. Dorthin war er aufgebrochen, um den unehelichen Sohn seines Bruders Daniel zu finden. Dessen Spur verläuft sich in den Wirren des Unabhängigkeitskrieges.
Auf gut fünfhundert Seiten entwirft Ned Gudgeon das Panorama seiner abenteuerlichen Reise, auf der ihm alles begegnet, was in Amerika damals unterwegs war: Sklaven und Indianer, Wegelagerer und marodierende Soldaten, englische Lords, feine (und weniger feine) Damen, Waffenschieber, Glückssucher und Spekulanten. Sogar George Washington gewährt dem Reisenden ein Stelldichein. Überlegungen dazu, wer der anonyme Gefängniswärter des Schreibenden sein könnte - ein feiner Gastgeber oder ein Folterknecht? - perforieren das illustre Spektakel. Während sich die Geschichte ihrem Ende zuneigt, der Papierstapel wächst, der Pegel des Tintenfasses sinkt, drängen sich die diesbezüglichen Spekulationen in den Vordergrund.
Bis schließlich, kurz vor dem Ende des langen Romans, die Tür der Zelle sich öffnet und Erzählbewegung und die erzählte Bewegung zu einem kunstfertigen Finale verschwimmen. Alle Rätsel werden gelüftet. Inhaberin der Schlüssel, der tatsächlichen wie der virtuellen, ist Mrs. Craig: eine attraktive Frau, die Ned Gudgeon in Amerika kennengelernt hat, um die seine Sehnsüchte kreisen, die sich nun als Mutter des verlorenen Neffen, des titelgebenden Bastards erweisen wird. Jener Bastard welcher, der Leser ahnt es bereits, die ganze Zeit direkt vor seiner Nase saß, ohne daß irgendwer sich dessen hätte ganz sicher sein können.
Der Engländer James Wilson hat einen ambitionierten Roman geschrieben, in dem sich die Spuren des Bildungs- und des historischen Romans kreuzen. Das Buch ist auch in sprachlicher Hinsicht auf Größe XXL angelegt: Leicht stelzend imitiert er das Genre des Reiseromans der Aufklärung, womit das achtzehnte Jahrhundert als literarisches Passepartout dient.
James Wilson ist versiert genug, diesen Umstand in vielen Details ironisch zu reflektieren. Ein französischer, entsprechend gepuderter Marquis, der eine Schlüsselrolle spielt, sieht aus wie der sprichwörtliche Comte eines Theaterstücks von Beaumarchais. Der titelgebende Bastard wiederum könnte John Lockes Theorie der tabula rasa illustrieren, über die man im England der Aufklärung mit heißen Ohren diskutierte. Denn es hat ein Kindstausch stattgefunden. Der gesuchte Bastard ist fern von seiner Mutter, der reizenden Mrs. Craig aufgewachsen. Diese nimmt statt dessen eine Tochter an, welche prächtig gedeiht. Der Junge aber wächst zu einem moralisch skrupellosen Mann heran.
All dies ist beeindruckend, sauber recherchiert, sorgfältig komponiert, und doch macht es nicht ganz glücklich. Die Stärke dieses opulenten Romans, sein verschlungenes Wesen, seine bemerkenswerte Gelehrtheit, ist auch seine größte Schwäche. Es ist so, als hätte man eine ältere Verwandte zum Tee geladen. Sie redet pausenlos. Alles stimmt, alles steht miteinander in Beziehung. Man schaltet ab, nickt, hört nach einer Weile wieder hin, hat nicht allzuviel verpaßt und kann auch der Conclusio, die mit leichtem Tremolo vorgetragen wird, noch folgen.
TANYA LIESKE
James Wilson: "Der Bastard". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Rita Seuß und Thomas Wollermann. Insel Verlag, Frankfurt/Main 2005. 524 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Viele lobende Worte hat Rezensentin Tanya Lieske für James Wilsons Roman "Der Bastard" übrig, wirkliche Begeisterung will sich bei ihr allerdings nicht einstellen. Als ambitioniert wertet sie das umfangreiche Werk, eine Kreuzung aus Bildungs- und historischem Roman, der opulent das Panorama einer abenteuerlichen Reise durch das Amerika des achtzehnten Jahrhunderts entwerfe. Auch sprachlich sei das Werk auf XXL angelegt: Leicht stelzend imitiere Wilson das Genre des Reiseromans der Aufklärung, womit das achtzehnte Jahrhundert als literarisches Passepartout diene. Lieske hebt hervor, dass der Autor versiert genug sei, dies "ironisch zu reflektieren". Doch obwohl sie den Roman insgesamt sorgfältig komponiert findet, macht er sie "nicht ganz glücklich". Aber warum eigentlich? Lieske antwortet mit einem aufschlussreichen Vergleich: "Es ist so, als hätte man eine ältere Verwandte zum Tee geladen. Sie redet pausenlos. Alles stimmt, alles steht miteinander in Beziehung. Man schaltet ab, nickt, hört nach einer Weile wieder hin, hat nicht allzuviel verpasst und kann auch der Conclusio, die mit leichtem Tremolo vorgetragen wird, noch folgen."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH