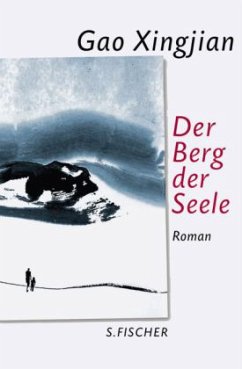"Der Berg der Seele" ist der große autobiografische Roman des chinesischen Nobelpreisträgers Gao Xingjian. 1983 beschließt er, der sich abzeichnenden politischen Repression in der Hauptstadt zu entfliehen. Er begibt sich auf eine Reise, die ihn den Fluss Yangtze hinab von der Quelle bis ans Meer führt, in das Herz eines unbekannten China.

Das große Vermögen des Gao Xingjian erreicht uns nur in kleiner Münze / Von Mark Siemons
Die Vertrautheit, die sich beim Lesen des Romans "Der Berg der Seele" von Gao Xingjian einstellt, ist trügerisch. Rasch meint man, auf alte Bekannte zu treffen: auf den Bewußtseinsstrom, die Auflösung des Subjekts in ungewöhnlichen grammatischen Strukturen, die Sehnsucht auch noch, der Kultur zu entkommen in einer "Authentizität", die sich jeder Beschreibung entzieht. Nach wenigen Seiten schon glaubt man genug über Gao Xingjian zu wissen; es ist in etwa das gleiche, was man sich schon dachte, als er letztes Jahr den Nobelpreis für Literatur bekam: ein mit sträflichem Wohlwollen überschätzter Epigone.
Aber Gaos Welt ist eine andere als die seiner westlichen Leser. Um sich davon zu überzeugen, sollte man die Lektüre besser nicht mit dem ersten, sondern mit dem 28. Kapitel beginnen. Die Szene schildert das abrupte Ende einer Busfahrt im Süden Chinas. Zuerst werden die Fahrgäste, unter ihnen der Ich-Erzähler, Zeuge, wie der Busfahrer einen Bauern schikaniert, den er beim Schwarzfahren erwischt. Er läßt ihn das Geld nachbezahlen, und danach wirft er sein Gepäck aus dem Bus und fährt so rücksichtslos an, daß der Bauer sich nur noch mit einem kühnen Sprung zur Seite retten kann. Doch dann halten ein Mann und eine Frau mit roten Armbinden den Bus an, Aufseher der Landstraßenbehörde. Sie stellen fest, daß der Fahrer von einem 3-Yuan-Ticket die Ecke nicht abgerissen hatte, und zwingen ihn, auszusteigen und einen Strafzettel über 300 Yuan zu unterschreiben. Der Fahrer fleht und bettelt eine Stunde lang, doch es nutzt nichts, diesmal ist er es, der sich der Gewalt und der Willkür fügen muß. Die Aufseher ziehen ab, der Fahrer bleibt liegen, und die Fahrgäste brauchen eine halbe Stunde, um ihn, zunächst durch Zureden, dann durch Anbrüllen, dazu zu bewegen, weiterzufahren. Schon im nächsten Dorf hält er aber wieder an, der Bus müsse aufgetankt werden, und er macht sich aus dem Staub. Die Fahrgäste bleiben zunächst schimpfend im Bus zurück, aber als sich niemand um sie kümmert, steigt einer nach dem anderen aus und verliert sich in dem unter sengender Hitze daliegenden Dorf.
Man könnte die Begebenheit für eine Szene aus einem absurden Theaterstück halten (also auch wieder epigonal), doch sie ist nichts als eine ohne besonderen künstlerischen Aufwand wiedergegebene Miniatur aus dem chinesischen Alltag von heute. Die Ohnmacht der Leute gegenüber der Macht der Stärkeren, ihr Fatalismus, die Herrschaft der Willkür, die überall lauernde Gewalt und Depression: All dies ist in der kleinen Szene enthalten. Vielleicht liest man den "Berg der Seele" am besten zunächst als eine Sammlung von Alltagsgeschichten: von Frauen, die sich ausgebrannt und alt fühlen, von Kindern, die im Fernsehen die Programme gegen "geistige Verschmutzung" sehen, von Parteikadern, die immer neue Versammlungen einberufen, um über ihre Arbeit zu berichten und von der Zentrale mehr Geld zu bekommen.
Man wird den Exaltationen dieses Buches nicht gerecht, wenn man sie vor allem auf Parallelen zur westlichen Moderne hin abklopft und sie nicht zunächst auf dem Boden solcher bodennahen Schilderungen wahrnimmt. Der "Roman" besteht aus 81 Kapiteln, von denen jedes, allenfalls lose mit den anderen verbunden, eine Episode erzählt: die Begegnung mit einer Frau, ein Naturerlebnis, ein Gespräch mit einem Mönch, eine historische Reminiszenz, eine Legende, eine Kindheitserinnerung, ein spekulativer Exkurs. Der gemeinsame autobiographische Nenner ist die Reise, die der Autor Anfang der achtziger Jahre unternahm, nachdem sich ein Verdacht auf Krebs als falsch herausgestellt hatte und er zugleich fürchtete, im Zuge neuer Repressionswellen wieder in die Fänge der Zensoren und Literaturüberwacher zu geraten.
So ist "Der Berg der Seele" gleichzeitig ein persönliches Tagebuch und eine Erkundung des kollektiven Ichs Chinas. Beides hebt sich ab von der Erfahrung der Kulturrevolution, in der den Menschen sowohl ihre Intimität als auch ihre Geschichte genommen wurden. Das "Ich" wurde ausgelöscht und durch ein starres "Wir" ersetzt. Ein gut Teil der erzählerischen Anstrengungen Gaos konzentriert sich darauf, die verfemten Personalpronomen zu rehabilitieren. Die einzelnen Kapitel sind abwechselnd aus der Perspektive eines "Ich" erzählt, das in den Süden Chinas reist, um die "Wirklichkeit" zu finden, und eines "Du", das den sagenumwobenen Lingshan, den "Berg der Seele" und seine Wahrheit sucht; später treten noch ein "Er" und eine "Sie" hinzu. Der Wechsel der Stimmen ergibt sich nicht immer zwingend aus der Dramaturgie und dem Inhalt; doch als permanentes Selbstgespräch ist er zunächst als Selbstbehauptung der Subjektivität zu verstehen.
Und dennoch kann sich der Leser des Eindrucks eines abgeschmackten Wiederaufgusses von Avantgarden nur schwer erwehren. Man braucht des Chinesischen nicht mächtig zu sein, um sich davon zu überzeugen, daß dies zu einem gut Teil an der Übersetzung liegt: Es genügt ein Blick in die wunderbare, vom Autor selbst revidierte französische Übertragung von Noel und Liliane Dutrait. Der Ton hat hier eine so bezwingende Leichtigkeit und Suggestivität, daß er den Leser von Anfang an in die Erzählung hineinnimmt und nicht mehr losläßt. Wie sich Jugendliche in einem abgelegenen Nest Südchinas unterhalten, wie sie Sonnenblumenkerne kauen und sich leichthin auf die Schulter schlagen, das bekommt allein durch die Sprache eine außerordentliche sinnliche Evidenz und Stimmigkeit. Die deutsche Übersetzung steckt dagegen nicht nur voller sprachlicher Unbeholfenheiten; sie verfälscht das Original auch dadurch, daß sie an die Stelle einfacher Ausdrücke wie "wirklich" oder "bodenständig" Begriffe aus einer ästhetizistischen Tradition des Westens setzt wie "echt" und "authentisch". So nimmt die grobkörnige Übertragung das vermeintliche Ergebnis von Gaos Recherchen vorweg: die Ankunft Chinas in der ästhetischen Moderne des Westens.
Doch so einfach macht es sich Gao nicht mit seiner Untersuchung, auf welchem geistigen und existentiellen - das heißt dann aber für einen Schriftsteller auch: auf welchem sprachlichen - Boden er die Welt und sich selbst heute wahrnehmen kann. Den westlichen Leser mag auf Dauer das Monologische irritieren, das Personen und Geschehnisse der äußeren Welt weniger in ihrem Eigengewicht wahrnimmt denn als Spiegel der eigenen Seele. Doch das steht ganz in der Tradition der großen chinesischen Dichter, die als verbannte Beamte am Yangtse sitzen und Natur und Welt fern von sich vorüberziehen sehen.
Gaos Erzählerstimmen schlüpfen in die verschiedenen Ichs der Sucher und Weisen Chinas. Gao erfährt sie und ihre Legenden durchaus als seine eigene Geschichte, als sein Land, aber im Unterschied zu seinen Vorgängern hält ihn dieses Über-Ich China nicht mehr: Er wird sich mit ihrer Hilfe nur um so mehr seiner radikalen Vereinzelung bewußt. Sprachlich wie inhaltlich halten sich so Tradition und Moderne fortwährend in der Balance, ohne sich gegenseitig zu neutralisieren. Der Mensch könne sich nicht von seinen Masken befreien, heißt es an einer Stelle, und das führe zu unermeßlichen Qualen. Das 36. Kapitel, das mit den feinsinnigsten und vergeistigsten Ideen von Mönchen in einem alten buddhistischen Kloster begann, endet mit einem Brand, der alles unter sich begräbt. "Nach der Katastrophe blieben nur diese Ruinen und Bruchstücke zerbrochener Stelen übrig, Studienobjekte für künftige Generationen." Gao Xingjians Pessimismus wird ironischerweise dadurch bestätigt, daß ihn deutsche Leser an dieser Übersetzung kaum werden nachvollziehen können.
Gao Xingjian: "Der Berg der Seele". Roman. Aus dem Chinesischen übersetzt von Helmut Forster-Latsch, Marie-Luise Latsch und Gisela Schneckmann. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2001. 548 S., geb., 58,48 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Rezensent Mark Siemons empfiehlt, diese "Sammlung von Alltagsgeschichten" zu lesen. Der aus 81 Kapiteln bestehende Roman sei gleichzeitig "ein persönliches Tagebuch und eine Erkundung des kollektiven Ichs Chinas". Den Exaltationen des Buches werde man nicht gerecht, wenn man sie "auf Parallelen zur westlichen Moderne hin" abklopfe. Der Rezensent gibt sich viel Mühe, den chinesischen Nobelpreisträger nicht auf das Vorurteil "ein mit sträflichem Wohlwollen überschätzter Epigone" festzulegen. Er weist darauf hin, das Gaos Welt eine andere ist, als die seiner westlichen Leser. Gaos China sei von der Erfahrung der Kulturrevolution geprägt, die den Menschen ihre Intimität und auch ihre Geschichte genommen hätte. Das "Ich" sei durch ein starres "Wir" ausgelöscht worden, weshalb sich "ein gut Teil der erzählerischen Anstrengungen" darauf konzentriere, "die verfemten Personalpronomen zu rehabilitieren". Den Eindruck "eines abgeschmackten Aufgusses von Avantgarde" hat laut Siemons vor allem die bis zur Verfälschung reichende "Unbeholfenheit" der Übersetzung verschuldet. Ein Blick in die französische Ausgabe genügte, und Siemons wurde von der "bezwingenden Leichtigkeit und Suggestivität" der Sprache nicht mehr losgelassen.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"