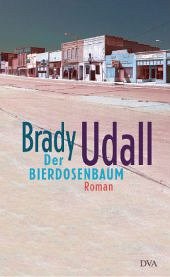Ein amerikanischer Schelmenroman - die Geschichte des kleinen Edgar Mint, der sich so fabelhaft wie anrührend durch seine Kindheit schlägt, verlassen von Gott und der Welt, aber mit einem großen Ziel, das er nicht aus den Augen verliert.Mit sieben wird Edgar Mint von einem Postboten überfahren, doch damit nicht genug: Als er endlich aus dem Krankenhaus entlassen wird, steht er ganz allein da und muß sich durch Schule und Leben kämpfen. Aber Edgar ist zäh, und er weiß der Welt die eigene Wirklichkeit entgegenzusetzen. Auf seiner Schreibmaschine, einer Hermes Jubilee, füllt er Blatt um Blatt mit seinen Wünschen, seinen Gedanken - und Briefen an den Postboten, dem er unbedingt mitteilen will, daß es ihm gutgeht. Edgar macht seinen Weg, eines Tages, da ist er sicher, wird er ankommen, wo immer das sein wird. Edgar Mint ist ein moderner amerikanischer Simplicius Simplicissimus - und unvergeßlich.

Brady Udall erlebt das Internat als Vorhölle / Von Klaus Ungerer
Dies ist die eine Hälfte der Wahrheit: "Ließe sich mein Leben in einem Wort zusammenfassen", sagt Edgar Mint, "dann in diesem: Unfälle." Die Feststellung ist eher fatalistisch denn klagend und allemal berechtigt. Spürbares Unglück verfolgt den Helden aus Brady Udalls Debütroman auf Schritt und Tritt, und leichter hätte er's, wenn die Wendung "Schlag auf Schlag" ihre Berechtigung hätte. Denn was sind schon Schläge! Was den jungen Edgar ereilt, sind Mißhandlungen und Demütigungen der grobschlächtigeren Sorte, und die schwerste von ihnen steht am Anfang: Als der Erzähler drei Jahre alt ist, krabbelt er unter den parkenden Wagen eines Postboten. Der fährt an. Und zermalmt Edgars Kopf.
Hier könnte dessen Geschichte schon enden, eine weitere gallenbittere Fußnote aus dem Indianerslum - mit dauerberauschter Nüchternheit vielleicht noch ein paar Jahre lang erzählt, dann dem Untergang und Vergessen anheimgegeben wie Edgars trunksüchtige Mutter, seine wutgeladene Großmutter, wie die gesamte Kultur, deren traurigen Überresten Edgar entstammt.
Edgar, das Halbblut, ist auf seine Weise ein all American guy, sein Zustandekommen eine späte, farcehafte Reprise jenes Zivilisationskampfes, der blutig und schmutzig ausgefochten wurde, ehe die Sieger das Land zur kulturellen Begegnungsstätte erklärten. Tumber weißer Mann erobert Squaw - dies ist die kürzestmögliche Fassung von Edgars Existenzanbahnung. Das schlichte Hollywoodmuster aber findet sich ausgeführt in einer Welt, die keine Romantik kennt. Edgars abgehalfterter Vater kapriziert sich auf ein spätes Cowboytum. Er nimmt an einem Rodeo teil, einzig um der Squaw zu gefallen. Seine Heldentat besteht darin, sich von einem alten Bullen namens "Wicked Joseph" zuschanden bocken zu lassen. Stolz präsentiert er sich der Angebeteten im Zustand kompletter Derangierung, mit gebrochener Rippe und gewonnenem Einkaufsgutschein: Warum sie sich ihm hingibt, ist nicht zu verstehen, es sei denn, man stellt eine innere Ziellosigkeit in Rechnung, mit der der Apachenslum wohl jeden infiziert. Edgar ist für seine Mutter selber ein Unfall, für den Vater aber ein Fluchtgrund.
Edgar, der Vaterlose, ist so unsterblich, wie einer nur sein kann, ein Heros des Erduldens. Dies scheint sein Auftrag auf Erden: alles denkbare Leid zu überleben. Der Matschkopf ist nur der Anfang und sein qualvolles Wiedererwachen eine recht kommode Vorhölle. Im Krankenhaus, seiner neuen Heimat, sind die Körperkrüppel und ihre Seelenruinen unter sich, im Grunde herrscht Ruhe. Mancher bewegt sich kaum, keiner kann den anderen mißhandeln, auf den Gipfeln der Verzweiflung gibt es doch auch eine Solidarität im Selbsthaß. Sogar Freundschaft ist möglich. Edgars engster Gefährte heißt Art und soll ihm ein Leben lang treu sein. Freund Nummer zwei ist die Schreibmaschine, eine Hermes Jubilee, auf die Edgar bald unentwegt eintippt. Inmitten des Menschenuntergangs gibt es sogar ein Erlebnis der Hoffnung: Art, der alles verloren hat, läßt Edgar durchs Fernrohr hineinschauen in eine andere Welt. Ein Blick in die dunkle Nacht hinein, ein Warten auf das Aufleuchten von Erzglut, ein Blick auf Arts altes Zuhause, das immerhin die Möglichkeit von Heimat verheißt. Ein Blick zu einer tiefen, tiefen Grube, die viel später im Buch der Ort der Befreiung sein wird.
Bis es soweit kommt, muß Edgar sein persönliches Inferno durchleben: die Willie-Sherman-Schule, ein Internat, in dem sich eine besonders renitente und gewalttätige Auslese von Kindern versammelt hat. Hier begrüßt der Direktor den Demolierten mit dem entsetzten Ausruf "Gott bewahre!", hier ist er für niemanden mehr das Hätschelkind, hier lernt er, daß Gewalt keineswegs nur unglücklichem Zufall entstammt. In dieser Schule funktioniert sie im Gegenteil sehr zielgerichtet, hier wird der Schwächste nach allen Regeln heranwachsender Kunst malträtiert, und wer ganz unten steht, vergnügt sich mit Fröschen.
Gleich zur Begrüßung und ohne rechten Anlaß wird Edgars armer, ramponierter Kopf von den neuen Mitschülern zusammengetreten, dann lernt der Neuling die Inkompatibilität von Gelesenem und Gelebtem kennen: "Friß Scheiße, Marty", sagt er zu einem seiner Quälgeister, er hat diesen Spruch einer Klowand entnommen und sich gemerkt. Wo der Kachelbekritzler jedoch keinen Widerspruch zu erwarten hat, kann sich im realen Leben jeder Satz gegen den Verwender wenden - nach einer ekelhaften Lektion revidiert Edgar seinen aktiven Wortschatz. Noch lange wird man ihn beschimpfen und ausnutzen und verlachen, Mutter und Großmutter werden sterben, Edgar wird sein Bett in der Nacht durchnässen und dabeisein, wie ein Mitschüler erhängt aufgefunden wird: Freitod. Einer wie Edgar. Das Leben ist eine Abfolge von Tiefschlägen.
Wenn jemand dies behaupten darf, dann er. Und doch verbirgt diese düstere Erfahrung die andere Hälfte der Wahrheit: Nicht der Schlag ist das Leben. Das Leben ist in jenem, der ihn erfährt. Edgar erträgt seine Torturen mit einem geradezu fühllosen Stoizismus, einem beinahe masochistischen Ja zu Leben und Erleben. Sosehr die Katastrophen zu Edgar gehören, so gehört ihm doch im gleichen Maße die Resistenz. Seine Geschichte erzählt er mit Lakonie statt Lamento und in einem warmen Grundton, der manchen Schmunzler zuläßt und nur einen Schluß: Dies Erdendasein, es lohnt sich.
Bevor Edgar uns all dies aber erzählen kann, hat er die Aufgabe zu lösen, vor die ihn sein Autor gestellt hat. Er lernt, sich zu wehren, zwar zaghaft und zaudernd, aber doch. Der Fluch von der Toilettenwand ist sein erster Versuch, er wird noch furchtbar bestraft. Edgar aber begreift nach und nach: daß er nicht zerstörbar ist. Und daß er den Torturen etwas entgegensetzen muß. Zwei Dämonen gibt es vor allem, die ihn verfolgen. Der eine ist aus demselben sozialen Schlick geformt wie er selbst, ein Monstrum aus dem Reich der Perspektivlosen. Der zweite ist der Weiße, der ihm das Leben rettete, nachdem ihn ein Weißer zermalmte. Aus unerfindlichen Gründen stellt dieser Barry ihm nach, schön regelmäßig ist ein filmreifer Auftritt ihm sicher. Barry will Edgar bei sich haben. Edgar entzieht sich. Irgendwann genügt das nicht mehr. Edgar, der Wut im Grunde abhold, schlägt zurück, wie er schon gegen Nelson zurückschlug, den fetten Schulhof-Rabauken, den zorngetunkte Pfeile niederstreckten sowie perfide Kriegslist.
Zweimal setzt der Held sich zur Wehr gegen Stärkere, beide Male tauchen Figuren wie Schutzgeister auf und entfleuchen sogleich wieder. Als Nelson erlegt wird, ist Vincent Delaine zugegen, ein alternder Sänger indianischer Lieder, der die Schule besucht. Und als auch über Barry sich das Strafgericht zusammenbraut, taucht ein anderer Indianer auf wie aus dem Nichts und namenlos. Als Anhalter tritt er in Edgars fliehendes Dasein, greift ein und taucht wieder ab. Bald danach hat Edgar die hartnäckigste Plage endlich besiegt und müßte doch längst tot sein: "Die mexikanischen Sklavenhalter", sagt ihm ein Weggefährte, "schätzten die Apachen von allen Sklaven am meisten. Sie waren am teuersten, denn sie ertrugen mehr als alle anderen, egal, wie schlecht man sie behandelte."
Edgar selbst ist es, der uns sein Leben erzählt. Wie aber kann einer sprechen, der noch ein Kind ist und oft nur ein hilfloses Bündel im Terror? Brady Udall hat kompositorisch zur Brechstange gegriffen: In einem unvermittelt angehängten Ende hüpft die Erzählung einfach auf den komfortablen Zeitpunkt "dreizehn Jahre später". Von hier aus und in Sicherheit erstattet Edgar Bericht. So rechtfertigt sich der warme Ton, die zart ironische Darstellung der Torturen, denen er ausgesetzt war. Die Zeit hat auf den letzten paar Seiten alle Wunden geheilt - und das Schreiben als solches half mit. Wir verabschieden Edgar in seinem Zimmerchen, das bis an die Decke mit beschriftetem Papier angefüllt ist: Udalls Held ist natürlich ein Autor und somit Erfinder seiner selbst. Auch diesen Griff in die erzählerische Mottenkiste verzeiht man dem Buch gerne. Die Welt ist nicht mit gar zu vielen jungen Autoren gesegnet, die Brady Udalls Erzähllust und -laune besitzen.
Brady Udall: "Der Bierdosenbaum". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Henning Ahrens. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart und München 2001. 400 S., geb., 48,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Klaus Ungerer muss über einige schwerwiegende Mängel hinwegsehen. Aber das tut er gern. Da ist mal von einem schlichten Hollywoodmuster, dann vom Griff zur kompositorischen Brechstange oder in die erzählerische Mottenkiste die Rede. Trotzdem scheint dieser Debütroman so unausrottbar sympathisch zu sein, dass der Rezensent dem jungen Amerikaner sämtliche Schwächen verzeiht. Die Welt sei nicht gerade mit jungen Autoren gesegnet, bittet Ungerer um Verständnis für seine Großzügigkeit, die Brady Udalls Erzähllust- und Laune besäßen. Worum es geht? Um ein junges Halbblut, der auf Schritt und Tritt vom Unglück verfolgt wird und von seinem Autor durch ein ziemliches Inferno von Tiefschlägen geschickt wird. Am Ende wird alles gut, wenn man dem Rezensenten glauben darf. Aber vorher ist viel zu tun. Auch für den Leser wahrscheinlich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH