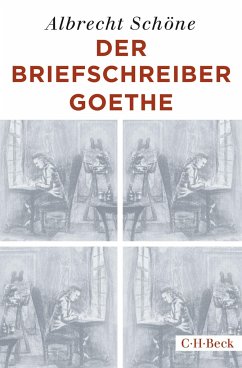Albrecht Schöne widmet sich in diesem Buch einem hochbedeutenden Bereich unserer Literatur, der durch die digitale Revolution untergegangen ist: der europäischen Briefkultur, auf deren Höhepunkt Goethes Briefwerk entstand. In neun exemplarischen Fallstudien - beginnend mit dem ersten Schreiben des 14-Jährigen und endend mit dem Brief des 82-Jährigen wenige Tage vor seinem Tod - erschließt er diese Briefe nicht nur als biographische Zeugnisse, sondern zugleich als sprachliche Kunstwerke. Voller Entdeckungen, frei von Wissenschaftsjargon, glänzend geschrieben und spannend zu lesen, wendet sich das Werk an alle, die sich für Goethe, für Literatur und Sprache oder überhaupt für das Briefschreiben interessieren.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
"In diesem reichhaltigen, ausführlichen Band entsteht ein differenziertes Porträt des sehr bekannten Briefschreibers aus Weimar, das fachwissenschaftlich anspruchsvoll ausgearbeitet ist und einen verlässlichen Einblick in Goethes Korrespondenzen bietet. Der Name Albrecht Schöne bürgt in der Literaturwissenschaft für Kenntnisreichtum, Qualität und auch stilistische Souveränität. Der alte Goethe hätte mutmaßlich nicht widersprochen."
literaturkritik.de, Thorsten Paprotny
"Eine einleuchtendere Goethe-Biografie als diese hier, die gar keine sein will, gibt es nicht."
Elisabeth von Thadden, DIE ZEIT
"Aus diesen brillanten Fallstudien treten Goethes Leben, die Kunst des Briefeschreibens und schließlich das Bild einer Epoche hervor."
Jeremy Adler, Neue Zürcher Zeitung
"Ein Buch, das so spannend ist, dass man es nur ganz langsam lesen mag, um es zu genießen."
Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung
literaturkritik.de, Thorsten Paprotny
"Eine einleuchtendere Goethe-Biografie als diese hier, die gar keine sein will, gibt es nicht."
Elisabeth von Thadden, DIE ZEIT
"Aus diesen brillanten Fallstudien treten Goethes Leben, die Kunst des Briefeschreibens und schließlich das Bild einer Epoche hervor."
Jeremy Adler, Neue Zürcher Zeitung
"Ein Buch, das so spannend ist, dass man es nur ganz langsam lesen mag, um es zu genießen."
Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensent Harro Zimmermann verneigt sich tief vor Albrecht Schöne und seinem neuesten Beitrag zur Goethe-Forschung. Ein Altmeister, ein Doyen der Germanistik sei hier am Werk, und "Der Briefeschreiber Goethe" einem jeden ans Herz gelegt, huldigt der Rezensent. Goethe war zeitlebens ein "emsiger Kommunikator in Schrift und Rede", das wusste Zimmermann schon zuvor, aber wie dicht die Briefe mit poetischen, philosophischen und politischen Überlegungen durchwoben waren, darüber konnte der Rezensent viel von Schöne lernen. Beim Briefeschreiben war Goethe um "radikale Selbstvergegenwärtigung" bemüht, er setzte Ausrufe ein, sparte aus, erfand Widerworte und Kommentare des Adressaten, inszenierte die Schreibsituation und versuchte alles in allem die authentische und innige Gesprächssituation mit Freunden und Vertrauten auch im Geschriebenen herzustellen, erklärt Zimmermann. Dabei unterlagen schon die Personalpronomina äußerster Reflexion, staunt der Rezensent, sei es nun das "seelenverbindende 'Du'" oder das "freundschaftliche 'Sie'".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH