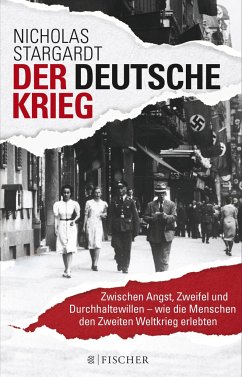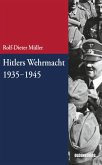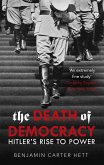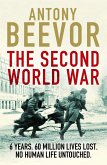Einzigartig und fesselnd erzählt der renommierte Oxford-Historiker Nicholas Stargardt in 'Der Deutsche Krieg' aus der Nahsicht, wie die Deutschen - Soldaten, Lehrer, Krankenschwestern, Nationalsozialisten, Christen und Juden - den Zweiten Weltkrieg durchlebten. Tag für Tag erleben wir mit, worauf sie hofften, was sie schockierte, worüber sie schwiegen und wie sich ihre Sicht auf den Krieg allmählich wandelte. Gestützt auf zahllose Tagebücher und Briefe, unter anderem von Heinrich Böll und Victor Klemperer, Wilm Hosenfeld und Konrad Jarausch, gelingt Nicholas Stargardt ein Blick in die Köpfe der Menschen, der deutlich macht, warum so viele Deutsche noch an die nationale Sache glaubten, als der Krieg längst verloren war und die Gewissheit wuchs, an einem Völkermord teilzuhaben. Ein verstörendes Kaleidoskop der Jahre 1939 bis 1945 im nationalsozialistischen Deutschland.»Ein Meisterwerk der Geschichtsschreibung, das die 'Vogelperspektive' nahtlos mit einer Mikrogeschichte dieser verhängnisvollen Periode des 20. Jahrhunderts verbindet.«Jan T. Gross»Erstmals wird die Chronologie der Stimmung, der Hoffnungen und Befürchtungen (...) der deutschen Bevölkerung während des Krieges wirklich sichtbar. Eine eindrucksvolle, fesselnde Darstellung.«Mark Roseman»Hervorragend geschrieben und in seiner Argumentation überzeugend, ist dieses Buch ein Muss.«Saul Friedländer
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
'Ein herausragendes Buch', schreibt der britische Historiker Ian Kershaw über Stargardts Buch. Dem ist nichts hinzuzufügen. taz 201510
Für den Publizisten Micha Brumlik, einst Leiter des Fritz Bauer Instituts, liegt die große Stärke von Nicholas Stargardts Buch darin, nicht den gewohnten militärhistorischen Blick auf den Zweiten Weltkrieg zu werfen, sondern anhand von Alltagsquellen wie Tagebüchern und Briefwechseln die Haltung der Deutschen zum Krieg zu untersuchen. Der australische Historiker Stargardt schließe eine Forschungslücke, so Brumlik, indem er das vermeintliche Nichtwissen um die Judenvernichtung als kollektive Lüge der Bevölkerung nachweise, mit dem Ziel einer systematischen Verdrängung. Zudem zeige der Autor mit seinem Buch, "dass Bundesrepublik und DDR nicht nur in ihren ersten Jahrzehnten auf Lebenslügen beruhten, sondern noch lange antisemitisch eingestellt waren", schreibt der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH