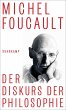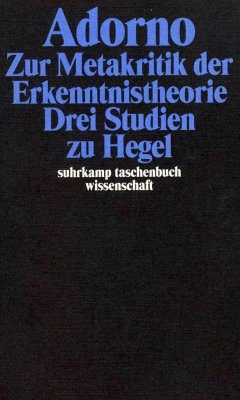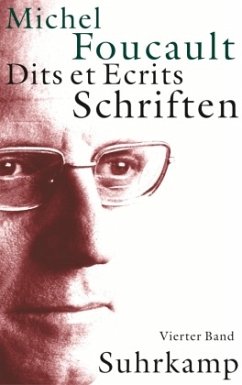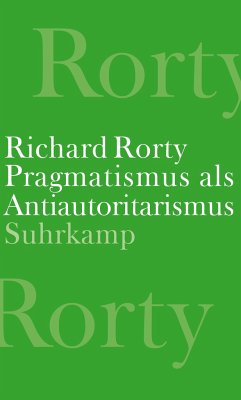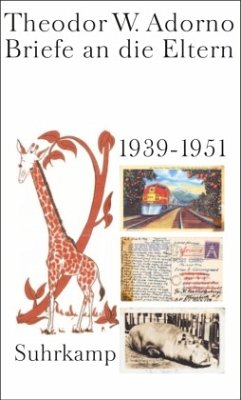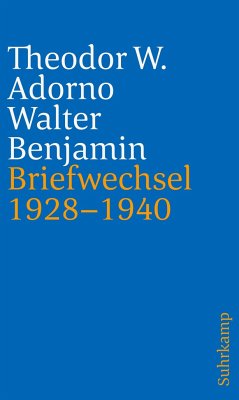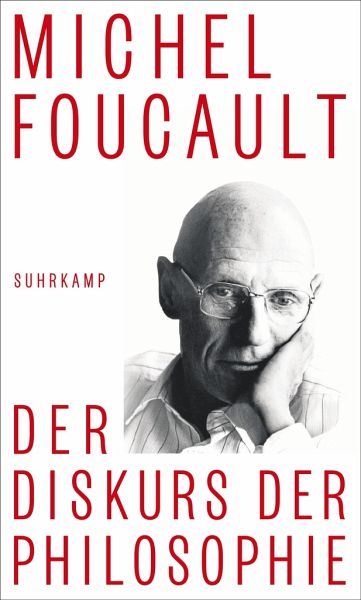
Der Diskurs der Philosophie
Bisher unbekannt und unveröffentlicht Foucaults Geschichte der Philosophie von Decartes bis zum 20. Jahrhundert
Übersetzung: Hemminger, Andrea

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Was ist Philosophie? Und welche Rolle spielt sie in der Gegenwartsgesellschaft? Zwischen Juli und Oktober 1966, einige Monate nachdem er durch das Erscheinen von Die Ordnung der Dinge schlagartig zum neuen Star der Philosophie aufgestiegen war, gab Michel Foucault in einem sorgfältig durchkomponierten Manuskript seine Antwort auf diese bis heute viel diskutierten Fragen. Im Gegensatz zu denjenigen, die entweder das Wesen der Philosophie enthüllen oder sie gleich für tot erklären wollen, begreift Foucault sie als einen Diskurs, dessen Ökonomie im Vergleich mit anderen Diskursen - wissensch...
Was ist Philosophie? Und welche Rolle spielt sie in der Gegenwartsgesellschaft? Zwischen Juli und Oktober 1966, einige Monate nachdem er durch das Erscheinen von Die Ordnung der Dinge schlagartig zum neuen Star der Philosophie aufgestiegen war, gab Michel Foucault in einem sorgfältig durchkomponierten Manuskript seine Antwort auf diese bis heute viel diskutierten Fragen. Im Gegensatz zu denjenigen, die entweder das Wesen der Philosophie enthüllen oder sie gleich für tot erklären wollen, begreift Foucault sie als einen Diskurs, dessen Ökonomie im Vergleich mit anderen Diskursen - wissenschaftlichen, literarischen, alltäglichen, religiösen - herausgearbeitet werden muss.
Der Diskurs der Philosophie schlägt somit eine neue Art und Weise der Philosophiegeschichtsschreibung vor, die von der reinen Kommentierung der großen Denker wegführt. Nietzsche nimmt allerdings einen besonderen Platz ein, da er eine neue Epoche einleitet, in der die Philosophie zur Gegenwartsdiagnose wird: Von nun an ist es ihre Aufgabe, einer Gesellschaft zu erklären, was ihr Zeitalter ausmacht. Nirgendwo hat Michel Foucault die Ambitionen seines intellektuellen Programms so deutlich gemacht wie in diesem Werk, das fast 60 Jahre nach seiner Niederschrift nun erstmals veröffentlicht wird. Eine kleine Sensation!
Der Diskurs der Philosophie schlägt somit eine neue Art und Weise der Philosophiegeschichtsschreibung vor, die von der reinen Kommentierung der großen Denker wegführt. Nietzsche nimmt allerdings einen besonderen Platz ein, da er eine neue Epoche einleitet, in der die Philosophie zur Gegenwartsdiagnose wird: Von nun an ist es ihre Aufgabe, einer Gesellschaft zu erklären, was ihr Zeitalter ausmacht. Nirgendwo hat Michel Foucault die Ambitionen seines intellektuellen Programms so deutlich gemacht wie in diesem Werk, das fast 60 Jahre nach seiner Niederschrift nun erstmals veröffentlicht wird. Eine kleine Sensation!