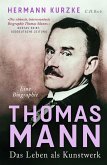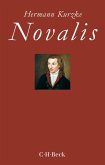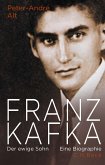Berlin, Anfang der Dreißigerjahre. Erich Kästner befindet sich auf dem Höhepunkt seines Erfolgs: «Pünktchen und Anton» und «Das fliegende Klassenzimmer» begeistern international, «Emil und die Detektive» wird 1931 verfilmt (Drehbuch Billy Wilder). Dann die Zäsur: Als die Nazis die Macht übernehmen, entscheidet sich Kästner, in Deutschland zu bleiben. Er, der kurz zuvor noch ein Spottgedicht auf Hitler verfasst hat, muss vor Ort mitverfolgen, wie seine Bücher verbrannt werden; bald darauf erhält er Publikationsverbot. Und doch gelingt es ihm, über die Runden zu kommen, und das nicht einmal schlecht. Er schreibt unter Pseudonymen, übernimmt Auftragsarbeiten, zuletzt auch für die UFA, die längst von Goebbels politisch instrumentalisiert wird. All das wirft Fragen auf: Wie weit passte Kästner sich im Dritten Reich an, wo bekannte er Farbe? Wie schmal war der Grat, auf dem er wandelte?
Tobias Lehmkuhl beleuchtet dieses Kapitel im Leben des großen deutschen Erfolgsautors. Wir begleiten Kästner bei seinen Streifzügen durch die Stadt, folgen seinem publizistischen Maskenspiel - und lernen dabei den Moralisten, Verseschmied und Schöpfer zeitlos-populärer Kinderbücher und Romane noch einmal neu und anders kennen.
Tobias Lehmkuhl beleuchtet dieses Kapitel im Leben des großen deutschen Erfolgsautors. Wir begleiten Kästner bei seinen Streifzügen durch die Stadt, folgen seinem publizistischen Maskenspiel - und lernen dabei den Moralisten, Verseschmied und Schöpfer zeitlos-populärer Kinderbücher und Romane noch einmal neu und anders kennen.

Über Kästner wie Kästner: Mit Gespür für Pointen traktiert Tobias Lehmkuhl in seiner Studie "Der doppelte Erich" das Verhalten des berühmten Schriftstellers im Nationalsozialismus. Dessen Lakonie verführt den Biographen bisweilen zu Spekulationen.
Von Patrick Bahners
Von Patrick Bahners
Das fünfte Kapitel von Tobias Lehmkuhls Studie über Erich Kästner im Dritten Reich behandelt die Romane der Jahre 1934 bis 1938 unter der Überschrift "Schnelles Umschaltspiel". Die Sportmetapher markiert die fraglichen Bücher, darunter "Drei Männer im Schnee" (1934), als Zeugnisse rascher, gekonnter Anpassung an die gewandelten politischen Verhältnisse. Es handelt sich um Unterhaltungsliteratur, in der heitere Verwicklungen einem glücklichen Ausgang zuarbeiten, um Antigesellschaftsromane von vollendeter Harm- und Zeitlosigkeit.
Einen Gebrauchsschriftsteller wie Kästner nötigte die Diktatur, seine Arbeitsprozesse weiter zu professionalisieren. Wo er sich seit jeher an Nachfrage und Gelegenheiten orientiert hatte, musste er nun zusätzlich die Verzerrung des Marktes durch die Befehle der nationalsozialistischen Kulturbürokratie einkalkulieren. Da Kästners Antrag auf Aufnahme in die Reichsschrifttumskammer abgelehnt wurde, durfte er in deutschen Verlagen nichts mehr veröffentlichen. Seine neuen Bücher erschienen daher in der Schweiz; ihr Import wurde zunächst noch geduldet. Bei den Buchprojekten dieser Jahre hatte Kästner von vornherein die Zweitverwertung auf dem Theater und im Kino im Auge. Autorschaft konnte in den kooperativen Künsten besser verschleiert oder durch Verwendung von Pseudonymen wenigstens pro forma unkenntlich gemacht werden. Hitlerdeutschland ähnelte in diesem Punkt den Vereinigten Staaten der McCarthy-Ära mit ihrem Strohmann-System in der Filmbranche. So galt auch für den Alltag von Kästners Arbeit nach der Entscheidung, das Deutsche Reich nicht zu verlassen, dass er jederzeit zum Umdisponieren bereit sein musste.
Das schnelle Umschaltspiel kommt aus dem Fußball und ist eine Errungenschaft der modernen Fußballtaktik. Als Kästner 1936 im Berliner Olympiastadion die italienische Nationalmannschaft im Halbfinale und im Finale des olympischen Fußballturniers sah, konnte er es noch nicht beobachten oder hätte er es jedenfalls noch nicht auf diesen technischen Begriff bringen können. Der Anachronismus der Metapher ist beabsichtigt. Es müsste dem Leser wohl aufs Gemüt schlagen, wenn Lehmkuhl alle bildlichen Ausdrücke zur Aufhellung und Auflockerung der Darstellung einer ernüchternden bis deprimierenden biographischen Materie der Lebens- und Vorstellungswelt der Dreißigerjahre entnähme.
Lehmkuhls Freude an der aparten Pointe, die dem Leser nahelegt, Kästner distanziert zu betrachten, ohne ihn vorschnell zu bewerten, zeigt, dass die Methode des Buches vom Gegenstand inspiriert ist. Feuilletonistisch geht Lehmkuhl an die Periode von Kästners Autorenleben heran, in der er keine Feuilletons mehr schreiben konnte. Schnelles Umschaltspiel: Auf die Machart des Buches passt das Bild noch viel besser als auf den Stoff des fünften Kapitels. Die Gliederung ist thematisch. Innerhalb der Kapitel lässt sich die Erörterung von Assoziationen leiten, sodass sie regelmäßig über das jeweilige Sujet hinausführt und sich sogar der Eindruck eines Montageverfahrens einstellt.
So erwartet der Leser nicht, dass das Kapitel mit dem Untertitel "Erich Kästner und die Reichsschrifttumskammer", das grundlegend sein muss, weil es von den Bedingungen von Kästners literarischer Tätigkeit nach 1933 handelt, am Anfang und am Ende ausgiebig Kästners Verhältnis zum Sport traktiert. Den Ausgangspunkt bildet der Essay "Sportgeist und Zeitkunst" von Marieluise Fleißer aus dem Jahr 1929, in dem die Autorin den "Sportsmann" zum repräsentativen "Menschentyp" der Epoche ausrief. Kästner soll nun aber, obwohl er Tennis spielte und die durch das Publikationsverbot unfreiwillig gewonnene Zeit in der heute vom Abriss bedrohten Tennisanlage hinter der Schaubühne am Lehniner Platz nutzte, gerade kein Sportsmann im Sinne Fleißers gewesen sein: Die "Kampfeinstellung des Lebensgefühls" aus Fleißers Definition habe ihm gefehlt.
Zeitkritische Texte von Kollegen zieht Lehmkuhl als eine Art Parallel- oder Ersatzüberlieferung zum Hintergrund von Kästners Biographie heran. Wenn Kästner 1944 seine Ausbombung in neusachlicher Unerschütterlichkeit mit dem Lebensbilanzsatz kommentiert, er sei "nie ein perfekter Wohner" gewesen, fällt Lehmkuhl dazu ein, dass Adorno im selben Jahr den Abschnitt "Asyl für Obdachlose" der "Minima Moralia" niederschrieb, wo er die "traditionellen Wohnungen" als "etwas Unerträgliches" qualifiziert und die "Arbeits- und Konzentrationslager" in einem Atemzug mit Bungalows und Trailerparks nennt. In einem beiläufigen Satz Kästners, das legt die überraschende Kontextualisierung nahe, steckt vielleicht ein ungeschriebenes Büchlein kritischer Antitheorie. Lehmkuhls Kombinatorik ist allerdings eher ein malerisches als ein analytisches Verfahren. Der berühmte letzte Satz von "Asyl für Obdachlose" darf nicht unzitiert bleiben: "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." Für die Beurteilung von Kästners Handlungen zwischen 1933 und 1945 ergibt sich daraus kein Maßstab, sondern eine Stimmung.
Der Titel von Lehmkuhls Buch, "Der doppelte Erich", kündigt eine Erzählung im Modus von Zwiespältigkeit und Zweideutigkeit an. In der Debatte über die Verstrickung von Intellektuellen in Hitlers Herrschaft ist der Dualismus als Deutungsschema von Anfang an präsent. Gottfried Benn gab seiner 1950 publizierten Rechtfertigungsschrift den Titel "Doppelleben", und Thomas Mann hatte für die Empfänglichkeit der Bildungsbürger für den Nationalsozialismus schon 1938 die unheimliche Formel vom "Bruder Hitler" gefunden. Den Roman "Das doppelte Lottchen", der 1949 herauskam, hatte Kästner im Krieg in Form eines Aufrisses für ein Filmdrehbuch entworfen. Die Grausamkeit der Umwelt findet Lehmkuhl in der Geschichte der Scheidungszwillinge wieder - ausgelagert in einen Traum: Lotte übernachtet bei ihrem Vater, dem gegenüber sie sich als Luise ausgibt, und erlebt im Schlaf, dass der Vater die beiden Töchter mit der Säge halbieren will. Lehmkuhl zieht die Parallele zu Brechts "Kaukasischem Kreidekreis", aber Kästners "ganze Zerrissenheit", die er in die Traumszene gepackt habe, bestimmt er als die private Tragödie "des Mannes, der auch Kind ist, der eins ist und als zwei sich fühlt".
Vergleiche mit dem Doppelgängermotiv in der Selbstdeutungsliteratur der 1945 Davongekommenen erübrigen sich, weil es bei Kästner viel älter ist: Ausfluss der Furcht vor dem Erwachsenwerden, das er sich als Abspaltung von der übermäßig geliebten Mutter vorstellte. Schon Carl Zuckmayer fand in seinem für den amerikanischen Geheimdienst erstellten Gutachten über die in Deutschland verbliebenen Schriftsteller in der "Mutterbeziehung" den "Schlüssel" zum Fall Kästner, die Erklärung für einen "erstaunlichen Mangel" an "Welt-Begreifen". Die Briefe und Postkarten, die Kästner täglich an seine Mutter in Dresden schickte, dienten der Konservierung der Symbiose von Ida und Erich Kästner, nicht dem Begreifen der politischen Welt.
Dagegen war das Tagebuch, das Kästner von 1941 bis 1945 mit Unterbrechungen führte, als Materialsammlung für jenen zeithistorischen Roman konzipiert und in Teilen sogar strukturiert, der seine Entscheidung gegen die Emigration rechtfertigen sollte. Aus Informationen dieser 2006 und mit erweitertem Kommentar 2021 edierten Quelle stellt Lehmkuhl instruktive Miniaturen einer Parallelbiographik zusammen: Er vergleicht Kästner mit Kollegen wie Walther Kiaulehn und Günther Weisenborn, die sich weniger passiv verhielten. Die extreme Lakonie der Notate verleitet Lehmkuhl allerdings zu Spekulationen, sodass er sozusagen Szenen des Romans ausarbeitet, den Kästner ungeschrieben ließ. Makaber wird das, wenn er sich ein hypothetisches Gespräch mit einem SS-Mann ausmalt, der mit seinen Mordtaten im Ghetto Litzmannstadt geprahlt hat.
Als missglückte Nachahmung Kästners muss man auch verbuchen, dass Lehmkuhl das Kapitel über die "Moralistik" des Autors des Romans "Fabian - Die Geschichte eines Moralisten" (1931) nicht nur mit "Kurz und bündig" überschreibt, dem Titel der Epigrammsammlung Kästners von 1948, sondern auch so kurz hält, dass er die Bedeutung der französischen Moralistik als eines Musters situationsangemessenen und dadurch regimekritischen Schreibens, für die etwa Hugo Friedrichs Montaigne-Buch von 1944 steht, gar nicht erwähnt. So bleiben Lehmkuhls Vergleiche Kästners mit Autoren in ähnlicher Lage punktuell. Das Buch ist eine Fortsetzungsglosse, eine Serie von Kommentaren zu Kästners Selbstauskünften, die für das Thema, wie Lehmkuhl eingestehen muss, im Grunde unergiebig sind, weil "weder die Briefe noch die Romane noch das Tagebuch nach 1933 eine Art Erkenntnis- und Entwicklungsprozess dokumentieren".
Wenn Kästners Lebensgefühl nicht auf Kampf eingestellt war, ist die Metapher vom schnellen Umschaltspiel schief, weil im Fußball von Abwehr auf Angriff und umgekehrt umgeschaltet wird. Hat der Weltfriedensfreund und Selbstgenussmensch mit sich gerungen, als er eine Haltung dazu finden musste, dass seine Landsleute sich zwölf Jahre lang als Kraftnaturvolk aufführten? Das Selbstgespräch des doppelten Erich kam über den gelegentlichen Fehlversuch nicht hinaus.
Tobias Lehmkuhl: "Der doppelte Erich". Kästner im Dritten Reich.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2023.
304 S., Abb., geb., 24,- Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Rundum zufrieden ist Rezensent Julius Zimmermann mit der Biografie, die Tobias Lehmkuhl über Erich Kästner mit Fokus auf dessen Leben im Dritten Reich geschrieben hat. Dass sich der Autor ambivalent gegenüber dem Regime verhalten hat, ist kein Geheimnis, weiß Zimmermann, er ist froh, dass Lehmkuhl keine vorschnelle eindeutige Positionierung vornimmt, sondern anhand von 14 Anekdoten "verschiedene Lesarten Kästners" ermöglicht, die dafür sorgen, dass sich die LeserInnen ein eigenes Bild machen können. Dem Kritiker gefällt, dass der Biograf sich zu beschränken weiß und gar nicht erst den Versuch unternimmt, eine umfassende Neudeutung vorzulegen. Natürlich werden dabei einige Aspekte eher kurz abgehandelt, räumt er ein, aber zu viele Details wären der Lebendigkeit dieser Erzählung vielleicht auch abträglich, wird resümiert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Je länger die Lektüre andauert, desto lebendiger und vielschichtiger ist das Bild, das man von Kästner gewinnt. Dafür gebührt Lehmkuhl Applaus. Die Zeit