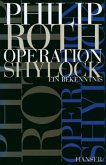Sussita ist kein Cocktail, auch keine glutäugige Schönheit, Sussita ist der Trabi des Nahen Ostens. Welch ungeahnte Wirkung dieses Nationalauto auf Menschen und Kamele hat, wie Lothar Matthäus und Rabbi Avramoff am defensiven Mittelfeld scheitern und der erste Kibbuz privatisiert wird, davon erzählt Robert Scheer mit einem ganz eigenen Humor in seinem Debüt. In zwölf miteinander verbundenen Geschichten zeigt er Bilder eines zutiefst zerrissenen Gelobten Landes, Israel mit all seinen Widersprüchlichkeiten und Verwerfungen. Brillante Komik, eine dezidiert politische Weltsicht, kakanische Umständlichkeit und orientalische Üppigkeit - das alles ergibt eine umwerfende Melange!

Ein literarisches Thema hat jedes Jahr neu Konjunktur: das Erwachsenwerden. Meist sind es Debütromane. Auch in diesem Herbst versuchen sich wieder vier Autoren daran - und ihre Adoleszenzpfade umspannen die ganze Welt.
Wenn das Ich so um die einundzwanzig Jahre alt sei, sagt der Vater, müsse es kantig werden. Es müsse sich - der Vater, der das sagt, ist jetzt richtig in Fahrt - der Gefahr aussetzen, es müssten die fremden Ansichten von ihm abfallen, es müsse das formlose Wattedasein hinter sich lassen und bis zum achtundzwanzigsten Lebensjahr auf Reisen gehen. Der Vater hat nur Gutes im Sinn, auch wenn er es genau so meint, wie er es sagt. Er sieht seinen Sohn Till, der als Einziger des Jahrgangs nicht zum Abitur zugelassen wurde. Daneben sieht er dessen Freund Jan, der dieses Abitur gerade hinter sich gebracht hat und nun plant, an allen möglichen Enden der Welt auf Plantagen zu arbeiten: "Work and Travel und so". Das ist ganz in des Vaters Sinn. Doch selbst wenn der eigene Sohn diese Vorstellungen nicht wörtlich umsetzen wird - das kann er nicht, sonst wäre er schließlich nicht sein Sohn -, so hat doch Till genau verstanden, worum es geht.
Es geht um die uralte Suche nach einer Identität, um das Formen einer Persönlichkeit und die Suche nach einem Platz in der Welt. Ums Erwachsenwerden, mithin um Dinge, die jedes Leben eine Zeitlang prägen und die deswegen immer wieder ihren Weg in die Literatur gefunden haben. Man muss dabei gar nicht ständig den großen Klassiker dieses Genres zitieren, den durch New York irrenden Holden Caulfield im "Fänger im Roggen". In so gut wie jeder Büchersaison erscheinen solche Coming-of-Age-Romane. Auch ein Blick auf die diesjährigen Herbstprogramme der Verlage zeigt vier oder sagen wir: dreieinhalb Debütromane, die sich genau diesen Fragen widmen - auf mal mehr, mal weniger gelungene Weise.
Einer, der eine radikale und deswegen bemerkenswerte Form gefunden hat, mit dem von Klischees und stets auch von Sentimentalität bedrohten Thema umzugehen, ist Kevin Kuhn. 1981 in Göttingen geboren, hat er den Hildesheimer Studiengang für Kreatives Schreiben belegt, seit zwei Jahren arbeitet er am dortigen Institut. Sein Roman "Hikikomori" greift das gewählte Sujet schon im Titel auf. Mit hikikomori bezeichnet man in Japan meist junge Männer, die sich, sei es aus Überforderung oder Bequemlichkeit, so lange von der Außenwelt isolieren, bis sie das Haus gar nicht mehr verlassen.
So macht es auch Till: Seine Freunde reisen in die Welt, er entrümpelt sein Zimmer in der elterlichen Wohnung und schließt sich ein. Am 85. Tag, den er dort allein verbringt, schreibt er seiner Freundin Kim eine Mail, in der er erklärt, er nehme es ihnen nicht übel, dass sie und Jan die Welt auf ihre Weise erkundeten. "Ich mache es ja auch auf meine weise. ich werde beweisen, dass im kleinen detail die ganze welt stecken kann und dass man bei der betrachtung des kleinsten in ungeahnte höhen gerät."
Nun hat Till nicht nur das Glück, ausgesprochen verständnisvolle Eltern zu haben, die seinen Emanzipationsversuch als das erkennen, was er ist, und ihn unterstützen - seine Mutter etwa lässt sich sogar darauf ein, mittels unter der Tür durchgeschobener Zettel seine Speisewünsche entgegenzunehmen. Till findet auch Gleichgesinnte. Im Internet entdeckt er eine Software, mit der er eine eigene Welt aufbauen kann, er nennt sie "Welt 0". Hierhin folgen ihm immer mehr Anhänger, als Gründer dieser Welt ist er ihnen eine Art König, ein Pygmalion auch, der schließlich beginnt, seine Lieblingsmitspielerin nach dem Bilde seiner realen Freundin Kim zu formen.
Nun ist das Buch von Kevin Kuhn aber keines über einen Jungen, der sich einfach in virtuellen Sphären verliert. Es ist ein Roman, der das Ineinanderfließen dieser Welten auf mehreren Ebenen imitiert: Als Tills Eltern ihm irgendwann doch die Heizung abdrehen, um ihn zur Aufgabe zu zwingen, erfriert auch in "Welt 0" alles Leben. Und als Till sein Experiment eines Tages tatsächlich beenden muss, findet er einen Weg, sich vor der Entscheidung für die eine oder die andere Welt zu drücken. Mit anderen Worten: Kuhn vereint zwei Daseinsformen miteinander, eine virtuelle - die man früher auch als eine märchenhafte hätte bezeichnen können - und eine reale, und spiegelt deren Ineinandergreifen geschickt in einer Erzählhaltung, die ständig zwischen den Innenansichten des Ich-Erzählers Till und der Übersicht eines auktorialen Erzählers schwankt. So lösen sich alle Grenzen auf und geraten letzte Gewissheiten ins Wanken. Und so wird aus einem sehr gewagten Experiment ein Debütroman von erstaunlich sicherer Intensität.
Weit weniger Risiko ist ein anderer Debütant eingegangen. Jan Sprenger, Jahrgang 1978, lebt seit ein paar Jahren im chinesischen Xi'an, wo er am dortigen Goethe-Institut arbeitet. Wie er nach China gereist ist, können wir nicht wissen, und strenggenommen tut das auch gar nichts zur Sache. Doch sein Roman "Kirgistan gibt es nicht" liest sich, als handelte es sich um eine leicht abgewandelte Version eines Reisetagebuchs. Man wird einfach den Gedanken nicht los, dass da jemand der Meinung war, jedwede persönliche Erfahrung reiche aus, um aus ihr einen Roman zu machen, und sei es auch eine gewöhnliche Reise, eine Art Grand Tour, wie sie junge Menschen zu Bildungszwecken schon immer gern unternommen haben. Jonas, der junge Mann, um den es hier geht, erzählt seinen Lesern von Olga, einer jungen Russin, die er in Bischkek getroffen hat. Man reist gemeinsam zum Issyk-Kul, einem großen See in Kirgistan. Dort treffen die beiden andere Backpacker, übernachten in Hostels, baden im See und haben Sex.
Jeder scheint sich hier in einem Zustand des Wartens häuslich eingerichtet zu haben, auch Jonas beschäftigt sich vor allem damit, zu beobachten, wie die sehr langsam vergehende Zeit ihn und die anderen verändert - sprich, ob Olga ihm eher mehr oder weniger zugetan ist. Strenggenommen reist Jonas gar nicht, er bewegt sich nicht frei, er lauert und passt sich an. Er besticht durch Phlegma und Feigheit, bevor er ganz zum Schluss plötzlich eine Entschlossenheit zeigt, die sich in nichts von dem, was auf den zweihundert vorangegangenen Seiten geschah, angekündigt hat und einem Deus ex Machina gleich in seine Glieder fährt.
Das Ganze ist nicht nur zu lang geraten und mit Sätzen gespickt, auf die man besser verzichtet hätte (und die ein guter Lektor streichen müsste), wie etwa: "Eine lange Reise verändert den Blick auf Dinge und Menschen" und "Das Glück einer Reise ist der Zufall, das, was nicht im Reiseführer steht, weil es nicht gesucht, sondern nur gefunden werden kann". Das Buch lässt vor allem reflektierte Distanz zu seinem Thema vermissen. Das äußert sich besonders an den Stellen, an denen Jonas Olga tatsächlich aus seinem Reisetagebuch vorliest. Mag ja sein, dass sie ihn darum bittet. Für den Leser bleiben diese Passagen dennoch ein Ärgernis, weil einfach nichts so langweilig ist wie die Reisetagebücher, Reisefotos und Reiseerinnerungen anderer Leute. Erst wenn man sie ausreichend verfremdet, wird zuweilen ein schönes Buch daraus.
Wie weit sich gerade diese Verfremdung treiben lässt, ohne dass der literarische Rahmen wegen Überlastung zerspringen muss, zeigt der Debütroman "Das große Leuchten". Sein Autor Andreas Stichmann hat einen Auszug daraus beim diesjährigen Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt vorgetragen. Der wurde zwar überwiegend gelobt, bekam letztlich aber keinen Preis, was schade ist, denn er hätte die mit einer Auszeichnung einhergehende Aufmerksamkeit verdient.
Stichmann, 1983 in Bonn geboren und am Leipziger Literaturinstitut ausgebildet, lässt die Grenzen realistischen Erzählens weit hinter sich und ersinnt eine Geschichte, von der sich oft nur schwer sagen lässt, auf welcher Ebene sie gerade angesiedelt ist: Ist es wirklich geschehen, dass Rupert, der jugendliche Held dieses Romans, seine Hippie-Mutter mit aufgeschnittenen Pulsadern in der Badewanne findet? Vermutlich. Richtig ist wohl auch, dass dieser Rupert danach bei seinem Freund Robert und dessen Mutter unterkommt, dass er dort, irgendwo auf dem Land, wo die Rapsfelder blühen, ein Mädchen namens Ana trifft und mit ihr durchbrennt. Was dann beginnt, ist ein kleines Roadmovie, und zwar wiederum auf doppelter Ebene: Rupert und Ana, die beiden mittellosen Ausreißer, finden in einer heruntergekommenen Wohnwagensiedlung am Rande einer Großstadt Unterschlupf. Dort, das gehört einfach immer dazu, haben sie Sex, treffen auf verlorene Gestalten und träumen von einer bürgerlichen Existenz - wenigstens Rupert tut das.
In einer Schlüsselszene des Romans, genau in der, die Stichmann in Klagenfurt vorlas, bricht Rupert in ein Haus ein. "Die Wohnung, die wir uns damals rausgesucht hatten, lag im Erdgeschoss, im normalsten Wohnblock der Welt, der aber zugleich der schönste Wohnblock der Welt war, wenn man ein Auge dafür hat." Rupert benimmt sich hier nun aber nicht wie ein normaler Räuber, er bestaunt vielmehr die schlichte Schönheit der spießbürgerlichen Existenz, die Schlüssel im Apothekerschränkchen und die mit Bleistift an der Küchenwand festgehaltenen Wachstumsschübe des Kindes. Schließlich phantasiert er sich selbst in diese Familie hinein, er probt ein normales Lehen, oder besser: Er kostet in Gedanken davon. Das alles aber wird im Rückblick erzählt. Was die Geschichte in der Gegenwart vorantreibt - im steten Wechsel mit den Episoden aus der Vergangenheit erzählt -, ist der zweite Teil des Roadmovies, der in Iran spielt. Denn irgendwann ist Ana verschwunden, Rupert vermutet sie auf der Suche nach ihrer Mutter in Teheran. Dorthin reist er ihr nach, lässt sich von einem schlauen Derwisch als gequälter Dummkopf beschimpfen und findet am Ende heraus, dass doch alles ganz anders ist, als er dachte.
Das Besondere an Rupert ist, dass er bei all diesen Reisen krampfhaft darum bemüht ist, Haltung und Übersicht zu bewahren. Er hat ständig das Gefühl, dass die Welt sich ihm entzieht, was ja nur eine andere Art ist, auszudrücken, dass er nicht weiß, wo er hinsoll. Sein größter und eigentümlichster Ehrgeiz gilt deswegen dem Nichtblinzeln: "Denn eines Tages, dachte ich, wenn man die Technik des Nichtblinzelns endgültig beherrschen würde, würde sich auch dieses letzte, schon farblose Etwas auflösen und dahinter würde das Niegesehene sichtbar werden: die wirkliche Welt, der rohe Raum. Das nackte und grauenhafte Draußen. Und darin sicherlich so was wie eine Struktur." Ganz gleich, wo er ist, ob er nun träumt, sich erinnert oder ob die Dinge wirklich passieren, Rupert sucht ständig nach einem Zustand, in dem sich Gedanken und Geschehen ineinanderfügen. Ja, man kann sagen, er träumt den alten Traum, den Sartre das An-sich-Sein genannt hat: eine vollkommene Kongruenz zwischen Welt, Wille und Vorstellung.
Dass es einen solchen Zustand nicht gibt, weil sich die Dinge dieser Art von letztgültigem Zugriff stets entziehen, schafft eine Verunsicherung, die Andreas Stichmann durch einen ständigen Wechsel der Wahrnehmungsebenen erlebbar macht - wobei er dieses Spiel so weit treibt, dass man am Ende nicht einmal mehr sagen kann, ob wenigstens Ruperts Reise nach Iran wirklich stattgefunden hat. Das ist mutig und gelungen. Und so verzeiht man ihm auch die eine oder andere Stilblüte, etwa "Speichel hatte sich in seinem Mundwinkel zusammengefaselt"oder "Die Himmelsstückchen in den Baumkronen waren blaue Blätter".
Das letzte Buch, das hier vorgestellt werden soll, Robert Scheers Debüt "Der Duft des Sussita", hat sich dagegen mit dem Auseinanderklaffen von Vorstellung und Realität schon lange abgefunden. Scheer, Jahrgang 1973, wurde in Rumänien geboren, lebte in Israel und ist seit ein paar Jahren in Deutschland. Obgleich seine Muttersprache Ungarisch ist, hat er sein Buch auf Deutsch verfasst - es sind zwölf Geschichten aus Israel, die lose ineinander übergehen. Wie Treibgut tauchen die Figuren mal hier, mal dort auf, während der Ich-Erzähler die israelische Wirklichkeit mit dem abgleicht, was sich Theodor Herzl in seinem Roman "Altneuland" einst von ihr erträumte. Natürlich ist nichts so geworden, wie er es einmal dachte: Hier fliegen Busse in die Luft, die Jugend zieht in den Krieg, und alte Männer träumen von Schweinefleisch. Israel erscheint als ein großes groteskes Gebilde, in dem nichts gilt, aber alles geht.
Es ist ein Buch, in dem sich die Verunsicherung des Einzelnen auf einen ganzen Staat ausgebreitet hat, wobei überhaupt nicht mehr entscheidend ist, was zuerst da war. Die Welt, das zeigen die Debüts der jungen Autoren dieses Herbstes, hat ihre Form verloren, sie hat sich aufgelöst und verflüchtigt. Sie wiederzufinden ist niemandem vergönnt.
LENA BOPP
Jan Sprenger: "Kirgistan gibt es nicht". Roman.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2012. 239 S., geb., 18,95 [Euro].
Andreas Stichmann: "Das große Leuchten". Roman.
Rowohlt Verlag, Reinbek 2012. 236 S., geb., 19,95 [Euro].
Kevin Kuhn: "Hikikomori". Roman.
Berlin Verlag, Berlin 2012. 223 S., br., 14,99 [Euro].
Robert Scheer: "Der Duft des Sussita".
Hanser Berlin Verlag, Berlin 2012. 155 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main