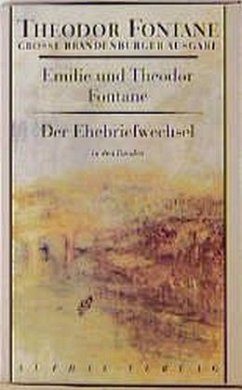"Ein unveröffentlichter Fontane-Roman" Vom ersten erhaltenen Gruß Fontanes an Fräulein Emilie Kummer in der Oranienburger Straße in Berlin bis zum berühmt gewordenen letzten Brief an die Frau, geschrieben an seinem Todestag am 20. September 1898, umspannt diese Korrespondenz ein halbes Jahrhundert. Lange Phasen der Trennung, bedingt durch Fontanes dienstliche und schriftstellerische Verpflichtungen, aber auch durch die schwierige wirtschaftliche Lage der Familie, werden durch den intensiven Briefwechsel überbrückt. Dessen Grundbedingung von Anfang an ist seine existentielle Notwendigkeit für beide Partner: Wie das Gespräch in Zeiten der Nähe, so gehört der ununterbrochene, zuweilen überbordende briefliche Austausch zum Wesen dieser Künstlerehe. Denn ohne die anhaltende innerfamiliäre Kommunikation hätte es auch den Erzähler Fontane nicht gegeben. Emilie Fontane, bisher nahezu ausschließlich aus der Perspektive ihres Mannes gesehen, tritt aus dem Schatten und spricht mit eigener unverwechselbarer Stimme. Aus ihren Briefen entsteht das lebendige Bild einer vielseitigen Frau in der Balance zwischen Anpassung und Selbstbestimmung. Von den 570 Briefen Fontanes werden 80 zum erstenmal publiziert und 300 in einer vollständigen und zuverlässigen Fassung dargeboten. Von Emilie Fontane konnten 180 Briefe ermittelt werden, von denen 150 erstmals an die Öffentlichkeit gelangen. So liefert die Fülle dieser Briefe auch dem Literaturwissenschaftler wie dem Historiker und Soziologen ein immenses Quellenmaterial. Gerade auch in den persönlichsten Zeugnissen entfaltet sich der Zauber von Fontanes Briefschreibekunst: tiefe Humanität und künstlerische Darstellungskraft - der unnachahmliche Fontanesche Erzählton macht diesen Briefdialog zu einer wundervoll unterhaltsamen Lektüre. Der Fontanesche Ehebriefwechsel ist zugleich Paarbiographie einer Schriftstellerehe und Quellenpublikation von editorisch einzigartigem Rang: teils erstveröffentlicht, teils erstmals vollständig und zuverlässig dargeboten, sind diese Briefe ein unschätzbarer Beitrag zur Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Der Ehebriefwechsel Band 1: Dichterfrauen sind immer so (1844-1857) Band 2: Geliebte Ungeduld (1857--1871) Band 3: Die Zuneigung ist etwas Rätselvolles (1873-1898) 3 Bände in Kassette Herausgegeben von Gotthard Erler unter Mitarbeit von Therese Erler
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Theodor und Emilie Fontanes Briefe / Von Peter von Matt
Das Lesen fremder Briefe hat immer etwas Unanständiges. Selbst wenn sie in dicken Bänden gedruckt vorliegen, einfühlsam eingeleitet und versehen mit sorgfältigen Kommentaren über zahllose vergessene Schauspielerinnen, Kommerzienräte und Bäckermeister, über Schlachtfelder und Opern und Seebäder, unanständig bleibt das Lesen trotzdem. Man sitzt mit einer Tarnkappe in einer fremden Stube und hört zu, wie die Leute einander Dinge sagen, die sie nie sagen würden, wenn sie wüßten, daß noch einer im Raum ist. Dabei macht nicht die Neugier die Sache anrüchig, sondern die Richterhaltung, in die man unwillkürlich gerät. Man sieht die kleinen Fiesigkeiten des Alltags, die man selber genauso produziert, und stellt fest, daß man sich darüber aufhält: Das hätte ich von dem nie gedacht! Aha, so eine war die! So selbstverständlich die Briefe heute zum Gesamtwerk der großen Autoren gehören, so unreflektiert ist meistens der Umgang mit ihnen unter den Aspekten zwischenmenschlicher Diskretion. Die historische Distanz vernichtet den privaten Schonraum.
Spannend bleibt es natürlich trotzdem. Und wenn, wie im Falle der Fontanes, eine ganze Ehe sich in einem Briefwechsel niederschlägt, eine Ehe, die von der ersten Verliebtheit bis zum Tod mehr als ein halbes Jahrhundert gedauert hat, dann bricht sich darin nicht nur eine Menge menschlicher Bedenklichkeiten, sondern auch eine soziale, politische und künstlerische Epoche. Wie in einer Glasscherbe am Straßenrand der Geschichte blitzt das deutsche 19. Jahrhundert in diesem Hin und Her zwischen zwei intelligenten und empfindlichen Menschen auf.
Dies ist die eigentliche Herausforderung der drei dicken Bände, die Gotthard Erler unter Mitarbeit von Therese Erler philologisch meisterhaft ediert und kommentiert hat: daß es einem gelingen muß, in den unendlichen Einzelheiten die großen Regeln der Epoche zu erkennen. Vom Keifen und Kneifen, vom Streicheln und Trösten zweier Eheleute, die nie genug Geld haben und immer Angst vor noch mehr Kindern, sollte man die Brücke schlagen können hinüber zum Existenzmuster des freien bürgerlichen Schriftstellers im letzten Jahrhundert. Denn da bedingt eines das andere. Die chronischen Kränkungen, denen der Autor Theodor Fontane in seiner Berufsarbeit ausgesetzt war, machten ihn reizbar wie ein verwundetes Tier. Dabei bleibt er nach außen durchaus der glänzende Gesellschafter, ein Causeur mit nie erschöpftem Vorrat von Zitaten und Anekdoten, und aus dem Stegreif konnte er reimen, daß die Gläser funkelten auf den besten Tischen von Berlin. Aber diese Außenschicht war ihm kein Schutz. Sie ließ jeden feinen Giftpfeil durch, der an den besten Tischen von Berlin auf den Zeitungsschreiber und Büchermacher beiläufig abgeschossen wurde, auf daß er nicht vergesse, was hoch und niedrig sei. In den Briefen an seine Frau schlägt dies auf doppelte Weise durch. Entweder schüttet er ihr sein Herz aus und klagt und schimpft über die gesellschaftliche Ecke, wo es ihn wieder einmal getroffen hat, oder er verwandelt die Kränkung auf der Stelle in Vorwürfe an Emilie. Der Mann zögert selten, das eigene Leiden dadurch zu dämpfen, daß er die Frau leiden macht. Das ist hart gesagt und dürfte so vielleicht gar nicht gesagt werden, aber wenn man sich schon mit der Tarnkappe in fremde Stuben setzt, muß man auch berichten, was man zu hören bekommt.
Daß beide Reaktionen möglich sind, spricht für die Partnerin. Sie hört sich immer alles sorgsam an und verschließt sich gegen keine Gestalt seines Zorns. Aber unbesehen läßt sie auch nichts gelten. Immer ist sie ein Widerpart von Rang, psychologisch hellhörig, unerschrocken im Parieren böser Ausfälle und an Lebensweisheit ihm durchaus gewachsen. Sie liebt ihn mehr, als er sie liebt. Dadurch ist sie ausgesetzter. Sie weiß aber auch, daß er es ohne sie nicht schaffen würde, das gibt ihr eine Art Überlegenheit. Und da sie wahrhaftig mehr zu leiden hat mit sieben Schwangerschaften und drei toten Kindern, will sie, daß er es mitträgt, auch wenn er erklärt, das störe ihn bei der Arbeit.
Im Grunde ist es das alte Tasso-Problem. Ein Autor, der weiß, was er wert ist, sieht sich überall freundlich begrüßt wegen seines Talents und seiner hübschen Verse, und überall ist die Freundlichkeit durchsetzt mit gönnerhaften Signalen: Siehst du, wie nett wir dich behandeln, obwohl du kein Geld hast! Und wenn die Signale einmal fehlen, hört er sie grimmig in die freundlichen Worte hinein. Er ist rundum "soupçonnös", argwöhnisch, was ihm Emilie mit seufzendem Nachdruck bestätigt, aber er ist es nicht von Natur aus, sondern infolge jener feinen Pfeile und Signale. Es gibt in den Briefen wütende Ausrufe gegen "die Hunde- oder mindestens Bedienten-Behandlung", die er sich gefallen lassen müsse (15. 8. 52). Dann wieder versucht er, die Vorgänge so genau wie möglich zu beobachten - woraus sich oft Paradestücke des Fontaneschen Ehedisputs ergeben: "Überall kommt mir die Stimmung in Bezug auf meine Person verschleiert vor, bei Wangenheims beträchtlich, bei Stockhausens nur ganz, ganz leise. ( . . .) Hundertmal frag ich mich, ob ich wohl Schuld sei, aber ich kann keine Schuld finden; ich bin artig, freundlich, gesprächig und wenn aus meinem Sprechen mitunter ein Ton der Besserwisserei herausklingen mag ( . . .), so muß man das hinnehmen ( . . .). Man würde mir die Stellung, die ich verlange, auch einräumen, wenn ich in einer ansehnlichen Lebensstellung wäre. So klingt das ,arme Luder' immer mit." (10. 6. 78) Da haben wir das Stichwort für den chronischen "Soupçon"! In jedem Lob, in jedem Widerspruch, beim Small talk oder in der heftigen Debatte, überall hört er den Unterton: "Ein armes Luder bist du doch!" Die Frau sieht das anders. Sie antwortet einen Tag später mit dem Satz: "Bei manchem möchte ich Dir doch auch zurufen: take it easy." Und trocken legt sie ihm ihre Diagnose auf den Tisch: "Daß die Genannten dich Alle lieben u. verehren, davon bin ich wie von meinem Leben überzeugt u. ich glaube auch angeben zu können, wodurch dann u. wann Deine Zweifel entstehen. Selbst sehr kühl u. wenig aufmerksam den Freunden gegenüber, bist Du in the long run so verwöhnt von allen Menschen, daß Du auch ein bissel viel Aufmerksamkeit verlangst. ( . . .) Nur Du bringst das Gefühl Deiner ,Stellungslosigkeit' mit, die anderen, mit Stellen etc., beneiden Dich darum und meist auch darum, daß Du reden kannst wie Dir der Schnabel gewachsen ist. ( . . .) Deine Wahrhaftigkeit und Dein auf den Grund gehen, genirt die Menschen, auch die besten u. dir wohlgewogendsten. (Mich nicht.)"
Dieses "mich nicht" ist zu beachten. Sie weiß, wie er auf solche Charakterskizzen zu reagieren pflegt, und will mit den zwei Wörtern den Vorwurf abfangen, nur sie selbst werde von seiner Wahrhaftigkeit "genirt". Aber die Prophylaxe versagt. Er antwortet umgehend mit einer zweiseitigen Gegendiagnose, und nun bekommt sie ihr Fett ab: "Es ist sehr liebenswürdig, daß Du auf meine vielleicht nur allzuoft wiederholte Klage eingehst und in aller Gütigkeit gegen mich, doch schließlich alles aus meinen eigenen Fehlern und Schwächen, großen und kleinen, erklären willst. Es hilft mir nun mal nichts, es mag liegen, wie es will, das Ende vom Liede bleibt doch immer, daß ich Unrecht habe. ( . . .) Du sekundirst immer meinem Gegner. Diesmal meinst du es sehr gut, aber es wird dadurch nicht richtiger. ( . . .) Ich dränge mich nirgends ein, man fordert mich auf zu erscheinen, und nachdem ich erschienen bin, Du wirst dies einräumen, schaff' ich Leben in die Bude. Dafür sollte man mir danken; ich habe Anspruch darauf, ,cajolirt' zu werden, denn, wie Du nur zu gut weißt, ich bringe Opfer wenn ich mich von meinem Buch und meinem Theetisch trenne und statt dessen in meine halbschmutzigen weißen Handschuhe fahre. ( . . .) Und das ist des Pudels Kern: ich bin, im gesellschaftlichen Leben, sehr artig, sehr milde, sehr zum verzeihen geneigt, und die andern sind es nicht."
Da spricht nicht der abgeklärte Weise mit der tröstlichen Botschaft vom "weiten Feld", sondern der scharfäugige, harte, richtende Mann, der die Maske des abgeklärten Weisen eines Tages für sich und seine Figuren erfindet - als eine der erlesensten Leistungen seiner Kunst. "Cajolirt" werden also will er, gehätschelt. Das erinnert auffällig an den Ausspruch des alten Grillparzer, der aus ähnlicher Verletztheit als Dramatiker verstummt war und seine wichtigsten Stücke nur noch in die Schublade stopfte: "Man hätte mich hätscheln müssen." Auch von Heine kennt man solche Jammerlaute. Eine seltsame Haltung bei diesen bürgerlichen Intellektuellen der ersten liberalen Generation, den Vordenkern und Aktivisten von 1848! Möchten sie denn im Grunde doch beim Adel unterkriechen oder von der neuen, reichen Bourgeoisie mit Zuckerbrot gefüttert werden?
So einfach liegen die Dinge nicht. Hier erscheint ein Symptom dafür, daß ein großes soziales Projekt der Epoche nicht funktioniert. Der Status des alten Adels, der Reichtum der neuen Unternehmer und die kulturelle Produktion der bürgerlichen Gebildeten, sie sollten nach einer verbreiteten Meinung von gleichem Rang und Wert sein. Für die Anerkennung ihrer geistigen Größe verzichten die Intellektuellen auf die Revolution. In Wahrheit aber läuft das Kapitel sowohl der Aristokratie als auch der Intelligenz unaufhaltsam den Rang ab. Es wird zum einzigen Maßstab. Ohne Geld ist der älteste Adel lächerlich, und der brillanteste Autor bleibt ein "armes Luder". Die erfolgreichen Unternehmer kaufen sich jetzt Adelstitel, und bei ihren Empfängen laden sie gern einen Schriftsteller ein zur Belebung der Tischgespräche.
Das Großartige an Fontane ist, daß er sich in seinen erbitterten Verdacht nicht haltlos verbeißt. Er stellt zwar die Forderung nach dem Gehätscheltwerden durch die Noblen und Reichen, aber er läßt es nicht bis zu Grillparzers wehleidiger Apathie kommen. Die Wut wird bei ihm zur Arbeit. Das jährliche Pensum seines Schreibens ist ungeheuerlich. Und bei aller Verachtung, die er gegenüber den aufstrebenden "Bourgeois" kultiviert - man lese dazu "Frau Jenny Treibel" -, gehört er doch auf seine Art zu ihnen. Er schaut ihnen ab, wie man's macht. Auf die Gefahr hin, zunächst ein noch viel ärmeres Luder zu werden, aber dafür vielleicht eines Tages doch noch ein Romancier, gibt er alle sicheren Anstellungen auf. 1870 verläßt er die Redaktion der "Kreuzzeitung", 1876 quittiert er nach drei Monaten schon das wohldotierte Amt eines Akademiesekretärs. Die Frau will darüber jedesmal fast verzweifeln. Er reagiert hart auf ihre Vorwürfe und trägt ihr diese länger nach als sie ihm sein Verhalten. Mit sicherem Instinkt und schlechtem Gewissen macht er sich zum freien Unternehmer, investiert in sein Talent, und den Ehedisput verwendet er zur Ableitung seiner inneren Spannungen. Auch das hat eine ökonomische Dimension.
Es gibt bei Fontane ein geheimes Wissen, daß die schweren Gefechte mit der Frau für ihn selbst von hygienischem Wert sind. Sein eigentlicher Gegner ist in schwer faßbarer Weise die Zeit und die gesellschaftliche Mentalität. Wenn er aber gegen Emilie antritt, wird der Widersacher eindeutig. Die schneidenden Analysen ihrer Person und ihres Eheverhaltens, die er in regelmäßigen Abständen liefert, sind intellektuell so anspruchsvoll, daß nur ein Mensch von ebenbürtiger Klugheit und Gefühlskultur sie versteht. Genau dies setzt er also bei ihr voraus, indem er es ihr abspricht. Eine famose Stelle findet sich im Brief vom 10. August 1880. Da legt er wieder einmal los mit einem Charakterbild, das, wie üblich, durchsetzt ist von Gesten des Verstehens, die in der Folge zu neuen Beweismitteln gegen die Frau werden. Am Ende aber, beim letzten Wort, passiert ihm eine Fehlleistung, ein Verschreiber von klassischer Qualität: "Aber das ist ja eben - ich sage dies ohne Vorwurf und fast ohne Klage - das schlimme Ding unseres Lebens gewesen, daß Du von schöner Nachsicht, von freundlichem Eingehn und von der Fähigkeit ein anderes Ich zu begreifen und gelten zu lassen, so wenig gehabt hast; in einem peinlichen Grade hat dir die Fähigkeit gefehlt, die Scheiterungen des Lebens in Allgemein-Stürmen oder gelegentlich doch auch in Dir selber zu suchen und Du hast es vorgezogen, immer wieder und wieder
Fontanes Entschluß, sich unabhängig zu machen und unabhängig zu bleiben - "Independenz über alles", heißt es am 28. Mai 70 -, hat zuletzt die grandiose Produktion seiner Romane ermöglicht. Er hat sich mit dem riskanten Akt nicht einfach die nötige Arbeitszeit verschafft, sondern dieser Akt setzte erst seine Willenskraft und den unternehmerischen Geist frei. Die Härte gegenüber der Familie verpflichtete ihn zum Erfolg. Bei der neuen Arbeit war die Frau als exzellente Leserin beteiligt. Es gibt Stellen, wo sie sich als Lektorin von professionellem Zuschnitt erweist. Wir können daraus entnehmen, wieviel der Autor aus den Gesprächen mit ihr gewonnen haben dürfte. Als er über "Graf Petöfy" sitzt, muß sie das Manuskript kopieren. Ihr Brief nimmt sich aus, als hätte sie eben ein Seminar über Romantechnik besucht, obwohl sie entschuldigend meint, sie gehöre nur "zum großen Publikum": "Die Handlung, Exposition fehlt mir; F. und E. [Felizitas und Egon, die Hauptfiguren] können doch nicht gleich in Liebe verfallen? er wirkt außerdem schemenhaft, man würde nicht begreifen, daß er kam, sah u. siegte. Sein Selbstgespräch: Weiter oder Rückzug? wirkt zu leidenschaftslos u. zu sehr wie von einem, der zu rechnen gewöhnt ist. ( . . .) Wenn F. so gleich dem ersten, besten, den sie sieht, zum Opfer fällt, dann muß der alte Graf ein schlechter Menschenkenner gewesen sein, daß er einen solchen Feuerbrand auf seine alten Tage nehmen konnte ( . . .) Liebesschilderungen, merkt man Dir doch zu sehr an, sind nicht Deine Sache." (14. Juni 1883) Daß sie dafür wieder eine Abreibung verpaßt kriegt, überrascht nicht. Ihr Brief beweist gleichwohl, auf welchem Niveau sich die beiden über die Kunst des Schreibens unterhalten konnten. Nur die verletzte Eitelkeit kann der Mann in der Antwort nicht verbergen: ",großes Publikum' bis du deshalb nicht, weil Du en détail einen sehr feinen künstlerischen Sinn hast, aber Du bist allerdings wie die meisten Frauen eine conventionelle Natur. Im Leben ist dies ein Glück, aber zur Beurtheilung von Kunstwerken, deren Zweck und Ziel ist sich über das Conventionelle zu erheben, zur Beurtheilung solcher Kunstwerke reicht natürlich der Conventionalismus nicht aus." Das tönt bös, und bös ist es auch, aber im gleichen Brief geht er auf Argumente so ausführlich und mit so komplexen Überlegungen ein, wie sie gegenüber einer tatsächlich "conventionellen Natur" undenkbar sind.
Mit der Opposition: Idylle oder Misere? kommt man dieser Ehe nicht bei, auch nicht mit noch mehr Psychologie, als die Beteiligten selbst schon liefern. Es mag sein, daß die zwei schwierigen Menschen mit harmloseren Partnern "glücklicher" geworden wären. Der deutschen Literatur aber würden dann mit Sicherheit mehrere ihrer besten Romane fehlen.
Emilie und Theodor Fontane: "Der Ehebriefwechsel". Herausgegeben von Gotthard und Therese Erler. Aufbau Verlag, Berlin 1998. 3 Bände, 2200 S., geb. in der Kassette, Subskr.-Preis 198,- DM; ab 1. März 1999 248,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Amüsant und spritzig lebendig erzählen die Briefe vom Kinderkriegen, von der Liebe und Anekdoten aus dem Leben der Fontanes.« Märkische Allgemeine Zeitung 20031103