Da ist er wieder, der Ton, der immer wiederkehrt, der zu Hause zu sein scheint in den Gedichten von Hans-Ulrich Treichel, ein Ton, der so tut, als sei Verlust zum Beispiel auf die leichte Schulter zu nehmen, nicht weiter schmerzhaft, vielmehr recht alltäglich, eine dazugehörende Erscheinung. Und die besänftigenden, so schwerelosen Gesten, die ihm von der Hand gehen, wollen den Eindruck des geringfügigen unterstreichen. Die kleinen Friedenauer Geräusche, das Fahrrad, das friedlich am Zaun lehnt; die wie lustig durchs Fernsehen flatternden Akten. Und dann ist geradezu zum Lachen, wie diese »Wendezeit« schließt: Vielleicht fahr ich doch noch mal rüber, an diesem mildwarmen Abend, Spitzel angucken und Sprüche austeilen. Der Autor hat Witz. Doch wer zu hören versteht, hört den bitteren Ton, irgendwo dahinter versteckt, der die Schnelligkeit und Forschheit Lügen straft. Die »Morgenandacht« endet: ...wer weiß schon, wie es wirklich um das Abendland steht. Oder die gerharnischten Empfehlungen, die das Gedicht »Politik der Lebensstile« austeilt. Und dann der Umschlag: die sehr willkommenen Liebesgedichte (...seit ich weiß daß selbst der Schlaf ein Erwachen selbst der Hunger ein Festessen ist). Und die Trauergedichte, so ohne alle Anstrengung - als antworte der Autor auf die Feststellung von Djuna Barnes: »Es genügt nicht, unglücklich zu sein, Du mußt auch wissen wie.«
Hans-Ulrich Treichels Gedichte sind lesbar, verwendbar und nachprüfbar, wie dieses Gedicht von einem Wintertag: Er gleitet am Fenster vorbei landet sanft auf gefrorenem Rasen blitzt kurz auf bevor er zwischen zwei Maulwurfshügeln versinkt.
Hans-Ulrich Treichels Gedichte sind lesbar, verwendbar und nachprüfbar, wie dieses Gedicht von einem Wintertag: Er gleitet am Fenster vorbei landet sanft auf gefrorenem Rasen blitzt kurz auf bevor er zwischen zwei Maulwurfshügeln versinkt.

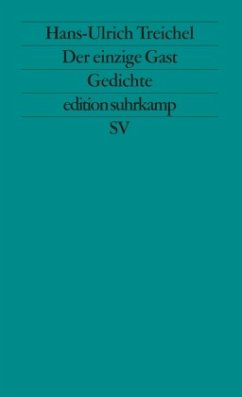







heikesteinweg_sv.jpg)