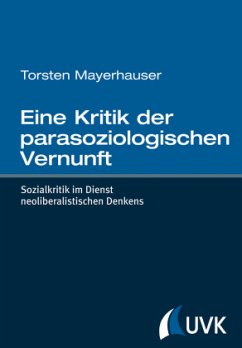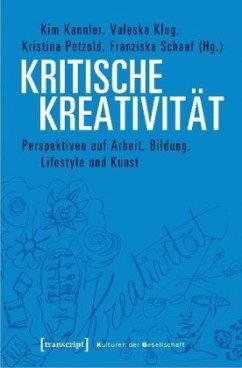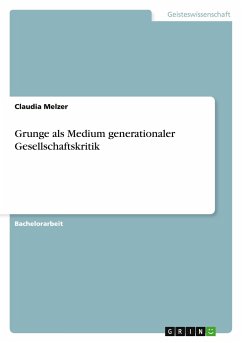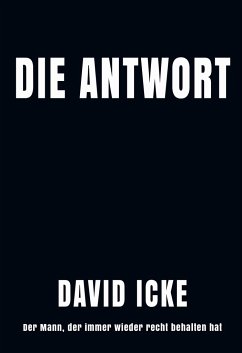Der Einzige und sein Eigenheim
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
20,50 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
'Eigener Herd ist Goldes wert' - die eigene Wohnung und mehr noch das eigene Haus bilden die Erfüllung und den Rahmen des bürgerlichen Familienlebens. Pierre Bourdieu und seine Mitarbeiterinnen haben diese scheinbare Idylle in einer umfassenden Untersuchung hinterfragt.Die erweiterte Neuauflage des 1998 erstmals erschienenen Bandes enthält u.a. vertiefte Ausführungen zur Methodologie sowie eine globalisierungskritische Einbettung der Thematik.