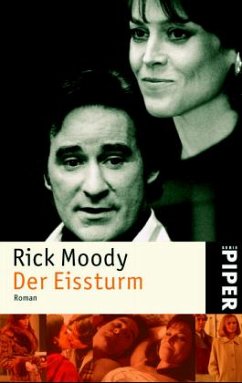Ein Weekend, die versammelte Nachbarschaft und ein Jahrhundertunwetter - die alltägliche Misere zweier ganz normaler amerikanischer Familien eskaliert, als ein Eissturm durch die Stadt fegt. Diese Misere relativen Wohlstands, tödlicher Langeweile, schal gewordener Liebe und unerfüllter Sehnsucht nach wahren Emotionen mündet in eine Eissturm-Party, die als Farce beginnt und als Tragödie endet.
Von Ang Lee mit Sigourney Weaver und Kevin Kline verfilmt.
Von Ang Lee mit Sigourney Weaver und Kevin Kline verfilmt.

Rick Moody sucht Amerika in den siebziger Jahren heim
Rick Moody wird bereits als der "Updike der neunziger Jahre" gefeiert. Wahr daran ist jedenfalls, daß sein "Eissturm" an einen Updike der siebziger Jahre erinnert. Nicht nur, weil der vierunddreißigjährige Universitätsdozent aus Brooklyn sich schon durch seine genaue Kenntnis der zeitgenössischen Populärkultur - Songs, Fernsehserien, Markenartikel und das ganze seelische Meublement mit seinen Rechtfertigungsmechanismen, Gurus und Modesekten - als Kind der frühen Siebziger erweist. Auch stilistisch ist er durch die Schule der Popkultur hindurchgegangen: Wo Updike die Seitensprünge und Midlife-Krisen skrupulöser Familienväter mit pfeifenschmauchender Behaglichkeit ironisiert, übergießt Moody ihre sexuellen Eskapaden auf dem Flokati-Teppich mit lakonischem Hohn. Seine Sprache ist härter, schnoddriger und schneller, sein Blick erbarmungsloser und doch romantisch sentimental.
Das Thema ist das nämliche: Was Updike in seinen "Erinnerungen an die Zeit unter Ford" beschrieb, leistet Moody für die Ära Nixons: eine präzise Schilderung ehelicher Liebe in Zeiten des Masters-Reports, des Familienlebens in Zeiten des Vietnam-Traumas und der ideologischen Ernüchterung. Beide, Updike und sein Enkel, erzählen vom Zwiespalt zwischen bürgerlicher Scham und modernem Lustprinzip: Männliche Eitelkeit, weibliche Frustration und verlorene kindliche Unschuld rütteln an den Fundamenten der Institution Familie. Am Ende kehren die Väter zwar, noch als Ehebrecher Versager, wieder in ihren Schoß zurück, aber es ist zu spät. Die Familie, Schutzgemeinschaft der Verlierer, bleibt ein Pandämonium von Einsamkeit und Kälte, "ein Bluff, eine Abfolge sinnloser Griffe nach der Macht".
Connecticut im Spätherbst 1973. Die Energiekrise hat die Aufbruchstimmung der Flower-Power-Generation abgewürgt. Zwar haben die Endmoränen der sexuellen Befreiung inzwischen die Provinz erreicht. Aber love and peace sind zum Pflichtprogramm des Partnertauschs, zur prästabilisierten Harmonie des "Ich bin o.k., du bist o.k." verkommen. Lüge und Illoyalität regieren die Watergate-Epoche, im Großen wie im Kleinen. Vom Traum der großen Freiheit sind nur die kleinen Freiheiten geblieben, die man sich als progressives Ehepaar auch im protestantischen Neuengland herausnehmen darf, ja muß. Auf "Schlüsselparties" wird die rituelle Promiskuität geprobt, und natürlich enden die "traurigen Ekstasen" erst recht im Katzenjammer.
Für Benjamin Hood endet die Orgie schon in postkoitaler Tristesse, ehe sie richtig begonnen hat. Janey, die attraktive Nachbarin, läßt den Karriere- und Ehekrüppel mitten im Akt sitzen; abends, bei der Bäumchen-wechsel-dich-Party, kommt er zu kurz, weil er sich zuviel Mut antrinken mußte. Hood ist der Don Quichotte der sexuellen Revolution, sein Leben eine Sickergrube voller Depression, Selbstmitleid und Doppelmoral. Kein Trost, daß auch seine Frau Elena, als sie sich mit dem Styropor-König Williams nach den Gesetzen des Zufalls paart, nicht über freudlosen Sex im ungeheizten Auto hinauskommt.
Wie die Alten, so die Jungen: Auch die Kinder der beiden Familien sind gefangen in einer komplizierten Symmetrie von Spiegelung und Wiederholung. Sie sind Opfer und Monster der antiautoritären Erziehung. Die Sehnsucht nach Liebe kämpft einen aussichtslosen Kampf mit ihrem pubertären Zynismus. Mit der Kindheit hat man ihnen auch die Zukunft genommen: Jetzt, frühreif und noch früher desillusioniert, kiffen und onanieren und träumen die Teenager bis zum Umfallen. Was im elterlichen Tauschverkehr Geld und Ehebruch, sind ihnen Kaugummis und Petting.
Wendy läßt sich mit den Williams-Knaben erwischen; am Ende findet sie im Bett des kleinen Sandy für einen prekären Augenblick Wärme und Ruhe. Mike, der "Manager ihrer Träume", stirbt in der Nacht, als der Blizzard kommt, durch einen Stromschlag. Die Komödie der sexuellen Irrungen schlägt in die Tragödie um, eben als das düstere Pandämonium sich zu lichten begann. Die Naturkatastrophe ist die Peripetie im Familiendrama: Sogar der ewige Verlierer Benjamin gewinnt dem sinnlosen Tod einen Sinn, einen Moment der Würde ab. Paul, der bis dahin in einer Comic-Phantasiewelt lebte, reift vom sensiblen Spinner zum Mann, taut in der Kälte zum Autor auf: auch eine Theodizee. Paul war, wie sich am Ende herausstellt, der Erzähler.
Rick Moodys zweiter Roman ist ein intelligentes, manchmal hochkomisches Stück Literatur. Gewiß, die Litanei der Sport-, Comic- und Fernsehhelden ist manchmal bloßes name dropping. Die Elementargewalt des Eissturms als Katalysator privater Konflikte einzusetzen ist auch nicht sonderlich originell. Aber Moody gewinnt dem Ewiggleichen einen neuen Ton ab. Sein Familienroman ist ein Marvel-Comic - und eine blasphemische Travestie: Die "Fabulous Four" des Williams-Clans sind die Heilige Familie von New Canaan. "Comics enden nie", sagt Paul einmal. "Es gab immer neue Verwerfungen im vermeintlich Unabänderlichen und Dauerhaften. Niemand starb, zumindest nicht für immer, kein Streit war vernichtend, kein Zerwürfnis endgültig." Und deshalb endet die Geschichte auch nicht gänzlich ohne Trost. Das Ende der halbstarken Comics, für Paul der "Beginn meiner Bekenntnisse", ist auch für Moody der Anfang kraftvoller Literatur. MARTIN HALTER
Rick Moody: "Der Eissturm". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Nikolaus Stingl. Piper Verlag, München 1995. 322 S., geb., 38,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main