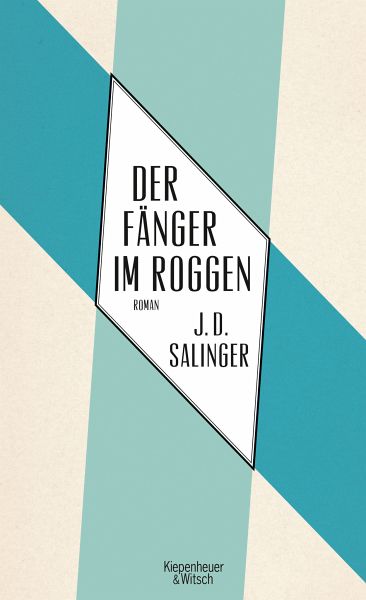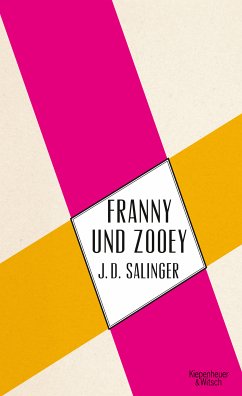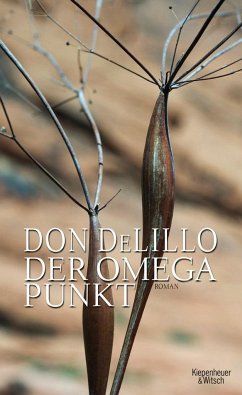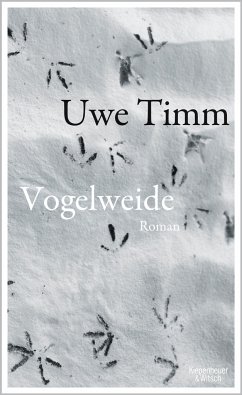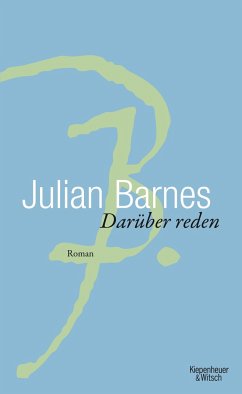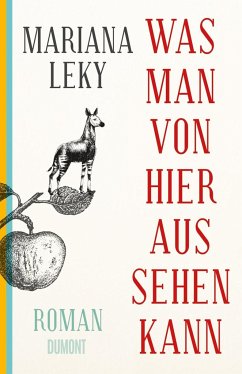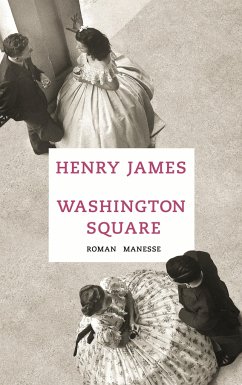PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Die neue Übersetzung von J. D. Salingers Der Fänger im Roggen von Eike SchönfeldHolden Caulfield ist eine Kultfigur der amerikanischen Literatur. Er ist sechzehn Jahre alt und irrt durch New York, traurig, krank, verwirrt. Generationen von Lesern haben sich in ihm wiedererkannt, in seinen Träumen und Hoffnungen, in seinen Ängsten und Schwierigkeiten, erwachsen zu werden.Nun spricht er mit einer neuen deutschen Stimme - frech und witzig, traurig und provozierend, ehrlich.1954 erschien im Züricher Diana Verlag der von Irene Mühlon übersetzte Roman Der Mann im Roggen von J. D. Salinger. E...
Die neue Übersetzung von J. D. Salingers Der Fänger im Roggen von Eike Schönfeld
Holden Caulfield ist eine Kultfigur der amerikanischen Literatur. Er ist sechzehn Jahre alt und irrt durch New York, traurig, krank, verwirrt. Generationen von Lesern haben sich in ihm wiedererkannt, in seinen Träumen und Hoffnungen, in seinen Ängsten und Schwierigkeiten, erwachsen zu werden.
Nun spricht er mit einer neuen deutschen Stimme - frech und witzig, traurig und provozierend, ehrlich.
1954 erschien im Züricher Diana Verlag der von Irene Mühlon übersetzte Roman Der Mann im Roggen von J. D. Salinger. Ein Schweizer Kritiker entdeckte, dass der Text verfälscht war; »unanständige« Stellen waren getilgt, Flüche verkürzt, durch Auslassungspünktchen ersetzt oder weggelassen. Man befand sich in den 50er Jahren ...
Der Diana Verlag verlor die Rechte, die Kiepenheuer & Witsch 1960 erwarb. Heinrich Böll überarbeitete und ergänzte die Schweizer Übersetzung. Unter dem Titel Der Fänger im Roggen, der sich auf ein Gedicht von Robert Burns bezieht, erschien 1962 die deutsche Ausgabe. Es begann der unglaubliche Erfolg dieses Romans - 60.000 Exemplare im Hardcover und im KiWi-Paperback, weit über 1 Million im Taschenbuch bei Rowohlt.
Die Übersetzung Eike Schönfelds zeigt die stilistischen Qualitäten des Romans in neuem Glanz, die raffinierte Sprache, die Kaskaden der Flüche, hinter denen Holden seine Verletzlichkeit verbirgt. Es ist, als lese man ein neues Buch - geschrieben für junge Leser von heute.
Holden Caulfield ist eine Kultfigur der amerikanischen Literatur. Er ist sechzehn Jahre alt und irrt durch New York, traurig, krank, verwirrt. Generationen von Lesern haben sich in ihm wiedererkannt, in seinen Träumen und Hoffnungen, in seinen Ängsten und Schwierigkeiten, erwachsen zu werden.
Nun spricht er mit einer neuen deutschen Stimme - frech und witzig, traurig und provozierend, ehrlich.
1954 erschien im Züricher Diana Verlag der von Irene Mühlon übersetzte Roman Der Mann im Roggen von J. D. Salinger. Ein Schweizer Kritiker entdeckte, dass der Text verfälscht war; »unanständige« Stellen waren getilgt, Flüche verkürzt, durch Auslassungspünktchen ersetzt oder weggelassen. Man befand sich in den 50er Jahren ...
Der Diana Verlag verlor die Rechte, die Kiepenheuer & Witsch 1960 erwarb. Heinrich Böll überarbeitete und ergänzte die Schweizer Übersetzung. Unter dem Titel Der Fänger im Roggen, der sich auf ein Gedicht von Robert Burns bezieht, erschien 1962 die deutsche Ausgabe. Es begann der unglaubliche Erfolg dieses Romans - 60.000 Exemplare im Hardcover und im KiWi-Paperback, weit über 1 Million im Taschenbuch bei Rowohlt.
Die Übersetzung Eike Schönfelds zeigt die stilistischen Qualitäten des Romans in neuem Glanz, die raffinierte Sprache, die Kaskaden der Flüche, hinter denen Holden seine Verletzlichkeit verbirgt. Es ist, als lese man ein neues Buch - geschrieben für junge Leser von heute.
Jerome David Salinger wurde am 1. Januar 1919 in New York geboren. In die Zeit von 1934 bis 1936 fallen Salingers erste literarische Versuche: Er ist Filmkritiker und Herausgeber der Kadettenzeitschrift Crossed Sabres.1940 veröffentlichte Salinger seine erste Kurzgeschichte 'The Young Folks' im Story Magazine. Salingers literarische Arbeit wurde von Autoren wie Ernest Hemingway, Gustave Flaubert, Rainer Maria Rilke sowie einigen der russischen Klassiker beeinflusst. Als sein bekanntestes Werk gilt der Roman 'Der Fänger im Roggen'. J. D. Salinger war mehrmals verheiratet und hatte zwei Kinder mit seiner ersten Ehefrau Claire Douglas. Salinger starb am 27. Januar 2010 in Cornish, New Hampshire, im Alter von 91 Jahren. Eike Schönfeld wurde 1949 in Rheinsberg geboren und wuchs in Schwäbisch Hall auf. Nach dem Studium der Anglistik und Germanistik in Freiburg promovierte er über Oscar Wilde. Von 1982 bis 1986 arbeitete er am Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen. Seit 1986 lebt er als freier Übersetzer in Hamburg. Er hat zwei Söhne. Übersetzungen (Auswahl) ¿ Oscar Wilde, Lord Arthur Saviles Verbrechen ..., Haffmans 1999 Das Bildnis des Dorian Gray, Insel 2014 ¿ J. D. Salinger, Der Fänger im Roggen, Kiepenheuer & Witsch 2003 Franny und Zooey, ebd. 2007 Hebt an den Dachbalken, Zimmerleute und Seymour - eine Einführung, ebd. 2012 Neun Erzählungen, ebd. 2012 ¿ Colin McAdam, Ein großes Ding, Wagenbach 2005 Fall, Wagenbach 2010 Eine schöne Wahrheit, Wagenbach 2013 ¿ Jonathan Franzen, Anleitung zum Alleinsein, Rowohlt 2007 Die Unruhezone. Eine persönliche Geschichte, Rowohlt 2007 Freiheit, Rowohlt 2010 (mit Bettina Abarbanell) Weiter weg, Rowohlt 2013 (mit anderen) ¿ John Updike, In einer Bar in der Charlotte Amalie (mit anderen), Rowohlt 2008 ¿ Shalom Auslander, Eine Vorhaut klagt an, Berlin 2008 Hoffnung. Eine Tragödie, Berlin 2013 ¿ Saul Bellow, Humboldts Vermächtnis, Kiepenheuer & Witsch 2009 Erzählungen, ebd. 2011 (mit anderen) ¿ Daniel Mendelsohn, Die Verlorenen, Kiepenheuer & Witsch 2010 ¿ L. K. Madigan, Blakes Gesetze der Fotografie, Carlsen 2012 ¿ Sherwood Anderson, Winesburg, Ohio, Manesse 2012 ¿ Richard Yates, Eine gute Schule, DVA 2012 ¿ Luke Williams, Das Echo der Zeit, Hoffmann und Campe 2012 ¿ David Lampson, Vom Finden der Liebe und anderen Dingen, Oetinger 2013 ¿ Sloan Wilson, Der Mann im grauen Flanell, Dumont 2013 ¿ Albert Borris, Zehn Gründe, die todsicher fürs Leben sprechen, Carlsen 2013 ¿ Charles Dickens, Der Weihnachtsabend, Insel 2014 Werke und Literaturprojekte ¿ Der deformierte Dandy - Oscar Wilde im Zerrspiegel der Parodie, Lang 1986 (Diss.) ¿ Black American English (Glossar, mit Herbert Graf), Straelener Manuskripte Verlag 1983, erweitert von Christiane Buchner, ebd. 1994 ¿ Abgefahren - Eingefahren Ein Wörterbuch der Jugend- und Knastsprache, ebd. 1986 ¿ alles easy Ein Wörterbuch des Neudeutschen, C. H. Beck 1995 Auszeichnungen 1997 Hamburger Förderpreis für literarische Übersetzung 2004 Ledig-Rowohlt-Übersetzerpreis für die Romane Nicholson Bakers 2008 Barthold-Heinrich-Brockes-Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds 2009 Preis der Leipziger Buchmesse, Sparte Übersetzung, für Humboldts Vermächtnis von Saul Bellow 2009 Deutscher Jugendbuchpreis, Übersetzung, für das Bilderbuch Geschichten aus der Vorstadt des Universums von Sean Tan 2011 Johann-Joachim-Bode-Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds - mit Johann Christoph Maass 2013 Christoph-Martin-Wieland-Übersetzerpreis für Winesburg, Ohio von Sherwood Anderson 2014 Internationaler Hermann-Hesse-Preis, zusammen mit Nicholson Baker sowie weitere Arbeits- und Reisestipendien des Deutschen Übersetzerfonds

Produktdetails
- Verlag: KIEPENHEUER & WITSCH
- Originaltitel: The Catcher in the Rye
- Artikelnr. des Verlages: 4000116
- 9. Aufl.
- Seitenzahl: 304
- Erscheinungstermin: 1. Januar 2003
- Deutsch
- Abmessung: 209mm x 128mm x 30mm
- Gewicht: 376g
- ISBN-13: 9783462032185
- ISBN-10: 3462032186
- Artikelnr.: 11221181
Herstellerkennzeichnung
Kiepenheuer & Witsch GmbH
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln
produktsicherheit@kiwi-verlag.de
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Michael Schmitts Besprechung klingt nach Erlösung: Endlich gibt es eine rundum gelungene Übersetzung von J. D. Salingers Kultroman "Der Fänger im Roggen". Der Übersetzer Eike Schönfeld habe die - 1995 erschienene - rekonstruierte amerikanische Originalfassung des "Fängers" als Ausgangstext benutzt und einen lakonisch-dichten deutschen Text geschaffen, dessen frische Sprache niemals "bemüht" klinge und auch nicht versuche, sich einer "künstlichen Jugendsprache" anzubiedern. Schönfelds Sprachgestaltung, so Schmitt, verleiht dem Werk eine "unvergleichlich viel größere Dynamik", verglichen mit Irene Muehlons gezierter und altbackener Fassung, die Heinrich Böll später nur "sanft" revidierte. Bei Schönfeld wirke Holden "plastischer", und auch alle andere Charaktere gewinnen an Profil. Dank Schönfeld, so das Fazit des Rezensenten, halten deutsche Leser nun den Schlüssel zum "Fänger im Roggen" in Händen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
perlentaucher.de
Und am Ende ein Roman, den wirklich jeder kennt: Jerome D. Salingers Fänger im Roggen, endlich neu übersetzt nach der ungeglätteten Originalausgabe. Reinhard Baumgart feiert in der "Zeit" ein "Wiedersehen nach langer Zeit", aber er äußert sich leise enttäuscht über Eike Schönfelds Neuübersetzung. Er nennt sie zwar gelungen, findet aber auch den Helden in seiner "Weinerlichkeit und Übertreibungsemphase" zur Kenntlichkeit entstellt. Auch Burkhard Spinnen in der "SZ" und Paul Ingendaay in der "FAZ" haben sich gerne auf die Zeitreisen begeben, und beide loben die Übersetzung, Spinnen weil sie die "Sprachmelange" des Protagonisten aus "Hingerotztem und Hochreflektiertem" so gut treffe, Ingendaay, weil sie sich der Sprache des Protagonisten "wie eine zweite Haut" anschmiege.
»Der Gewinn des neuen deutschen Fänger im Roggen ist Eike Schönfelds durchdachte und couragierte Übersetzung, die für diesen Roman ein zweites Leben bedeuten wird.«
(Paul Ingendaay, FAZ)
»Die Übersetzung Eike Schönfelds zeigt die stilistischen Qualitäten des Romans in neuem Glanz. Es ist, als lese man ein neues Buch - geschrieben für junge Leser von heute.«
(tele.at)
Und am Ende ein Roman, den wirklich jeder kennt: Jerome D. Salingers Fänger im Roggen, endlich neu übersetzt nach der ungeglätteten Originalausgabe. Reinhard Baumgart feiert in der "Zeit" ein "Wiedersehen nach langer Zeit", aber er äußert sich leise enttäuscht über Eike Schönfelds Neuübersetzung. Er nennt sie zwar gelungen, findet aber auch den Helden in seiner "Weinerlichkeit und Übertreibungsemphase" zur Kenntlichkeit entstellt. Auch Burkhard Spinnen in der "SZ" und Paul Ingendaay in der "FAZ" haben sich gerne auf die Zeitreisen begeben, und beide loben die Übersetzung, Spinnen weil sie die "Sprachmelange" des Protagonisten aus "Hingerotztem und Hochreflektiertem" so gut treffe, Ingendaay, weil sie sich der Sprache des Protagonisten "wie eine zweite Haut" anschmiege.
»Der Gewinn des neuen deutschen Fänger im Roggen ist Eike Schönfelds durchdachte und couragierte Übersetzung, die für diesen Roman ein zweites Leben bedeuten wird.«
(Paul Ingendaay, FAZ)
»Die Übersetzung Eike Schönfelds zeigt die stilistischen Qualitäten des Romans in neuem Glanz. Es ist, als lese man ein neues Buch - geschrieben für junge Leser von heute.«
(tele.at)
»Mit der Neuübersetzung erlebt man, um wie viel mehr das Deutsche selbst heute imstande ist, eine ebenso lebenssatte wie kunstvolle Alltagsrede darzustellen.« Burkhard Spinnen Süddeutsche Zeitung
Broschiertes Buch
Der 1951 erschienene Jugendroman "Der Fänger im Roggen" des kürzlich verstorbenen, umstrittenen Kult-Schriftsteller J.D. Salinger handelt von dem 17-jährigen Anti-Helden Holden Caulfield, der als Ich-Erzähler von seiner "Schulkarriere" berichtet. Holden …
Mehr
Der 1951 erschienene Jugendroman "Der Fänger im Roggen" des kürzlich verstorbenen, umstrittenen Kult-Schriftsteller J.D. Salinger handelt von dem 17-jährigen Anti-Helden Holden Caulfield, der als Ich-Erzähler von seiner "Schulkarriere" berichtet. Holden scheitert zum wiederholten Male an den Anforderungen einer Internatschule, hier die "Pencey Prep", auf die der auffällige und sensible, aber trotzige Jugendliche von seinem gut betuchten Eltern regelmäßig geschickt wird. Weder mit seinen Zimmernachbarn (wie Ackley und Stradlater) noch mit seinen Lehrern (wie Spencer und Turner) kommt er zurecht, er flüchtet aus dem Internat und begibt sich auf eine depressive Irrfahrt durch New York. Der stets fluchende und lügende Holden bezeichnet die ihm unsympathischen Menschen als "piefig" (engl. phony), benutzt dabei die für einen klassischen Roman völlig untypische Mischung von Jugend- und Umgangssprache, slang und Vulgärsprache.<br />In vielerlei Hinsicht haben wir eine recht reservierte Haltung gegenüber dem Roman Salinger's, Holden ist nicht unbedingt eine Figur, die als Sympathieträger zur Identifikation auffordert. Das Buch erfüllt nicht gerade die Erwartungen, die man aus jugendlicher Sicht hat, wie etwa actionreiche Spannung oder Love Strories mit Happy-End. Das Buch handelt eben nicht von einem Helden, sondern von einem verletzlichen und sensiblen Jugendlichen, der sich so gar nicht in der muffigen Erwachsenwelt einfinden mag. Für die Lektüre des Buches benötigt man schon ein hohes Maß an Ausdauer und konzentration, wer dies schafft, gewinnt tiefe Einblicke in die Phsychologie junger Menschen.
Weniger
Antworten 12 von 13 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 12 von 13 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Ich liebe dieses Buch, es ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Es ist so genial interessant und tiefgründig geschrieben, dass man es nicht mehr weglegen kann. Holden ist ein ganz normaler, etwas komischer junge, er hat ein einfaches fast bemitleidendes leben, man weiß nie was …
Mehr
Ich liebe dieses Buch, es ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Es ist so genial interessant und tiefgründig geschrieben, dass man es nicht mehr weglegen kann. Holden ist ein ganz normaler, etwas komischer junge, er hat ein einfaches fast bemitleidendes leben, man weiß nie was er als nächstes tun wird, es wirkt so als würde man das tagebuch seines stillen cousins lesen. Einfach klasse!
Weniger
Antworten 7 von 9 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 7 von 9 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Null Bock
Es gibt nicht viele Schriftsteller, deren Ruhm sich praktisch auf einen einzigen Roman gründet wie bei Jerome David Salinger mit seinem 1954 erschienenen Klassiker «Der Fänger im Roggen». Nicht nur dass unzählige Schüler und Studenten sich damals mit dem …
Mehr
Null Bock
Es gibt nicht viele Schriftsteller, deren Ruhm sich praktisch auf einen einzigen Roman gründet wie bei Jerome David Salinger mit seinem 1954 erschienenen Klassiker «Der Fänger im Roggen». Nicht nur dass unzählige Schüler und Studenten sich damals mit dem Buch als Pflichtlektüre befasst haben, das Jahrzehnt des Erscheinens seines einzigen Romans wurde in der US-amerikanischen Literaturgeschichte sogar häufig als «Ära Salinger» bezeichnet. Der ungemein erfolgreiche Roman hat die Leserschaft damals schon polarisiert, und er tut es heute immer noch. Was keineswegs gegen ihn spricht, wie ich meine.
Holden gehört nicht zu den Romanhelden, die man sympathisch finden oder mit denen man sich identifizieren könnte als Leser. Als 16-Jähriger hat er Probleme mit dem Erwachsenwerden, verweigert jegliche Leistung, die unabdingbar scheint auf dem Weg ins Leben. Und damit in eine Welt; die er zutiefst verachtet, weil er sie als verlogen durchschaut hat. Wegen seiner Null-Bock-Haltung fliegt er aus dem College und durchlebt eine traumatische Odyssee auf dem Weg nach Hause. Anders als Goethes Werther verzweifelt er an der Gesellschaft, sucht den alternativen Lebensentwurf. Erst spät wird ihm klar, dass er vom einfachen Leben träumt, in einer einsamen Blockhütte mit Frau und Kindern.
In diesem Szenario bewegt sich der nur drei Tage umfassende, einsträngig erzählte Plot, dessen Ich-Erzähler einerseits merkwürdig reif und altklug wirkt, der aber durchaus auch noch kindlich erscheint, insbesondere was seine Sprache anbelangt. An der scheiden sich nämlich die Geister, besser gesagt die Leser, es ist ein unflätiger Slang, der gleich mehrere Probleme aufwirft. Erstens ist so etwas immer schwer zu übersetzen, auch ist der Jugendjargon vor sechzig Jahren ein anderer gewesen als heute, und außerdem besteht generell eine Krux darin, dass die Generationen sich zuweilen auch sprachlich fremd sind. Eine im aktuellen Argot geschriebene Geschichte dürfte auf viele Leser genau so abstoßend wirken, mir fällt da als Beispiel spontan «Axolotl Roadkill» von Helene Hegemann ein. In vielen Rückblenden, oft als Bewusstseinsstrom erzählt, breitet Salinger das Leben seines Helden vor uns aus, er beginnt mit dem Satz: «Wenn ihr das wirklich hören wollt, dann wollt ihr wahrscheinlich als Erstes wissen, wo ich geboren bin und wie meine miese Kindheit war und was meine Eltern getan haben und so, bevor sie mich kriegten, und den ganzen David-Copperfield-Mist, aber eigentlich ist mir gar nicht danach, wenn ihr’s genau wissen wollt». Zu diesem sprachlichen Duktus gesellt sich ein köstlicher, unterschwelliger Humor, so wenn Holden zum Beispiel von seiner Großmutter schreibt: «… sie schickt mir ungefähr viermal im Jahr Geld zum Geburtstag». Oder er sinniert darüber, dass er sich eine Lungenentzündung holen könnte und daran stirbt. «Dann überlegte ich, wie diese ganze Blase mich in einen verfluchten Friedhof steckte und so, mit meinen Namen auf dem Grabstein und so. Um mich rum lauter tote Typen. […] Und dann kommen am Sonntag Leute und legen einem einen Strauß Blumen auf den Bauch und den ganzen Mist. Wer will schon Blumen, wenn er tot ist? Keiner». Er spricht häufig den Leser auch direkt an, so wenn er von seinem früh verstorbenen Bruder erzählt: «Ihr habt ihn ja nicht gekannt».
Die Gedichtzeile von Robert Burns «Wenn einer einen trifft, der durch den Roggen kommt» hat Holden falsch verstanden und «trifft» durch «fängt» ersetzt, in seiner Phantasie sieht er sich nämlich, wie er kleine Kinder fängt, die im Roggenfeld herumlaufen und eine Klippe hinunter zu stürzen drohen. Und auch er fällt letztendlich nicht, er ist geläutert durch seine kleine Schwester, die er innig liebt, die er beschützen will. Genau dies ist das Motiv, das im kryptischen Titel dieses berühmten, aber auch schwierigen Romans anklingt, der zu vielfältigen Interpretationen einlädt über Generationen- und Gesellschaftskonflikte wie auch über sexuelle, moralische und psychologische Aspekte.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Holden Caulfield ist sechzehn Jahre alt und ist zum wiederholten mal von der Schule geflogen. Außerdem glaubt er, sich auch bei seinen Mitschülern nicht mehr sehen lassen zu können, denn auf dem Weg zu einem Wettkampf hat Holden die komplette Ausrüstung seiner Fechtmannschaft in …
Mehr
Holden Caulfield ist sechzehn Jahre alt und ist zum wiederholten mal von der Schule geflogen. Außerdem glaubt er, sich auch bei seinen Mitschülern nicht mehr sehen lassen zu können, denn auf dem Weg zu einem Wettkampf hat Holden die komplette Ausrüstung seiner Fechtmannschaft in der U-Bahn vergessen. Kurz entschlossen fährt er nach New York und quartiert sich in einem billigen Hotel ein, nach Hause möchte er erst gehen, wenn der Brief seiner Schule bei den Eltern angekommen ist und sich die Wogen ein wenig geglättet haben. So beginnt Holdens Odyssee durch die Großstadt, in dieser Zeit trifft er viele mehr oder weniger seltsame Menschen und teilt seine Gedankengänge ausführlich mit dem Leser.
"Der Fänger im Roggen" von J.D. Salinger gilt als Klassiker und wird in einigen Büchern und Filmen erwähnt. Deshalb wollte ich das Buch auch kennen lernen, doch selten habe ich eine Rezension so lange vor mir her geschoben, wie diese. Sowohl dem Protagonisten, als auch der Schreibweise stehe ich zwiespältig gegenüber, Holden Caulfield ist am Anfang einfach nur nervig und da die Geschichte aus seiner Perspektive erzählt wird, ist die Satzbildung ziemlich monoton, irgendwann konnte ich sein ewiges "....und so." nicht mehr sehen.
Mit etwas Abstand kann ich dem Protagonisten zugestehen, dass er noch sehr jung ist, er fühlt sich groß und weise, den meisten seiner Altersgenossen begegnet er mit Abneigung und Überheblichkeit. Doch innerlich ist er noch ein kleiner Junge mit verklärten Vorstellungen von der Welt und fixen Ideen, wie er sein Leben fernab der vertrauten Pfade führen könnte, erst im Lauf der Handlung konnte ich ein wenig Entwicklung bei Holden fest stellen und etwas mehr Sympathie für den Jungen aufbringen.
In dieser Zwiespältigkeit liegt wohl die Faszination dieses Buches, der Grund warum es zum Klassiker wurde. Durch die ersten Seiten habe ich mich ziemlich durchgekämpft, später konnte ich immer noch nicht sagen, dass ich die Geschichte sehr mochte, aber sie hat mich auch nicht mehr los gelassen, so dass ich in jeder freien Minute weiter gelesen habe. Da ich die Lektüre weder als sehr gut noch als sehr schlecht bezeichnen kann, entscheide ich mich bei der Bewertung für die goldene Mitte und vergebe drei Sterne.
Fazit: Dieses Buch hat mich hin und her gerissen zwischen Abneigung und Faszination. Der sperrige Protagonist und seine nervige Satzbildung sind gewöhnungsbedürftig, doch im Lauf der Handlung konnte ich mehr Verständnis für Holden entwickeln und ihm sein jugendliches Alter zugute halten.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Mein erstes Buch des amerikanischen Schriftstellers J.D. Salinger und mit Sicherheit nicht das letzte. Es hat mich sehr fasziniert und halte lange nach. Kein Wegweiser, auch kein philosophisches Werk, kein rasanter Thriller, kein Manifest, keine Anklageschrift und dennoch hinterließ dieser …
Mehr
Mein erstes Buch des amerikanischen Schriftstellers J.D. Salinger und mit Sicherheit nicht das letzte. Es hat mich sehr fasziniert und halte lange nach. Kein Wegweiser, auch kein philosophisches Werk, kein rasanter Thriller, kein Manifest, keine Anklageschrift und dennoch hinterließ dieser Roman ein angenehme Empfindung in mir. Der Fänger im Roggen ist schon was ganz Besonderes, aufrichtig und authentisch, tiefsinnig und stellenweise sogar witzig.
Der Ich-Erzähler Holden Caulfield, befindet sich während seiner Aufzeichnungen zur Erholung und psychiatrischen Behandlung in einer Heilanstalt. Er erzählt uns wie er kurz vor den Weih-nachtsferien wider mal einen Schulverweis erhält. Aus Furcht vor der Reaktion seiner durchgeknallten Mutter und seinem beruflich erfolgreichem Vater, kehrt er nicht nach Hause, irrt stattdessen drei tagelang durch Manhattan. Dabei ist er auf der Suche nach sich, nach menschlicher Nähe, nach einem Weg seine weitere Zukunft zu gestallten.
Auf den ersten Blick scheint Holden ein Außenseiter, ein abgedrehter Einzelgänger, erst nach und nach versteht man, wie er versucht sich an der Welt anzupassen, dabei geht er stückchenweise kaputt und es entsteht eine Figur, die seinesgleichen noch lange suchen muss.
Manch einer wird sich die Zähne an diesem Buch ausbeißen, andere werden vielleicht meine Begeisterung für dieses Buch nicht nachvollziehen können, mir alles egal, denn ich bereue keine einzige Minute die ich mit und in diesem Buch verbracht habe.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
"Der Fänger im Roggen" ist eine Geschichte, das wir aus der Ich-Perpektive des Protagonisten Holden Caulfield erleben. Wir begleiten dessen Leben und Gedanken drei Tage lang, in der Zeit vor Weihnachten, in der er von seiner vierten Schule fliegt. Grund scheint hier aber nicht seine …
Mehr
"Der Fänger im Roggen" ist eine Geschichte, das wir aus der Ich-Perpektive des Protagonisten Holden Caulfield erleben. Wir begleiten dessen Leben und Gedanken drei Tage lang, in der Zeit vor Weihnachten, in der er von seiner vierten Schule fliegt. Grund scheint hier aber nicht seine Intelligenz zu sein, sondern eher sein Verhalten und seine Verweigerung, sich sonderlich anzustrengen. Da seine Eltern davon noch nichts wissen (der Brief muss erst ankommen), beschließt er, einfach abzuhauen. So erleben wir drei Tage im Leben des Jugendlichen und was ihm widerfährt.
Die Sprache ist salopp und Holden flucht gerne, benutzt gerne Wörter wie "piefig" und "verdammt". Vermutlich die passende Jugendsprache der 50er Jahre.
Besonders berührend finde ich die Verbindung zwischen Holden und seiner Schwester, hier ist dem Autor eine besondere Tiefe in der Geschichte gelungen, ebenso beim Zusammentreffen mit den beiden Nonnen.
Ich wusste vorher nicht viel über diese Geschichte, ich wusste lediglich, dass er als Klassiker unter anderem auch zur Schullektüre gehört. Es gibt viele Interpretationsmöglichkeiten, wie ich mittlerweile erfahren habe. Dazu muss ich sagen, ich habe es schlicht und einfach genossen, drei Tage lang die Gedanken mit Holden zu teilen und ihn in auf dieser kurzen "Reise" zu begleiten. Die Entwicklung seiner Gedanken und seiner Einstellung war interessant zu verfolgen, ebenso seine Kritik gegenüber Erwachsenen, armen und reichen Leuten oder auch seines Bruders und das machte diese Lektüre sehr kurzweilig.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Das Büch hat viele Himtergründe die es zu erkennen gibt. Drer Autor gibt uns einen Einblick in Welt eines Teenagers der auf der Schwelle zum Erwachsenwerden steht und sich mit der Welt der Erwachsenen nicht so recht anfreunden will. Auch wenn das Buch meiner Meinung nach einen sehr guten …
Mehr
Das Büch hat viele Himtergründe die es zu erkennen gibt. Drer Autor gibt uns einen Einblick in Welt eines Teenagers der auf der Schwelle zum Erwachsenwerden steht und sich mit der Welt der Erwachsenen nicht so recht anfreunden will. Auch wenn das Buch meiner Meinung nach einen sehr guten Einblick in die Welt dieses Jungentlichen bietet und ich denke dass das Buch gut gelungen ist, finde ich das es zu viele Eimzeheiten beschreibt und dass es insgesamt etwas zu langezogen ist. Vieleicht ist das auch Sinn der sache um diesen Efekt des Gefühlschaos so verdeutlichen aber für einen Jungen Leser wie mich (16 Jahre) einfach manchmal etwas zu breit getreten.
Weniger
Antworten 1 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für