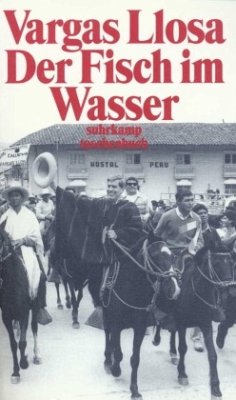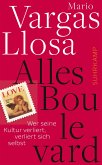"Ein kurzer biographischer Abriß: Als Zehnjähriger lernt er seinen leiblichen Vater kennen; achtzehnjährig heiratet er seine fast doppelt so alte Tante und nutzt die erste Gelegenheit, seiner Heimat zu entkommen. In Paris beginnt er ein Leben als freier Schriftsteller. Als einer der führenden Intellektuellen Lateinamerikas tritt er mit fünfzig Jahren in die aktive politische Arena seines Landes ein.
Geradlinig, offen und sehr direkt erzählt der peruanische Romancier Mario Vargas Llosa aus seinem ereignisreichen Leben, von Kindheit und Jugend und seinen Erfahrungen als Präsidentschaftskandidat in Peru.
"
Geradlinig, offen und sehr direkt erzählt der peruanische Romancier Mario Vargas Llosa aus seinem ereignisreichen Leben, von Kindheit und Jugend und seinen Erfahrungen als Präsidentschaftskandidat in Peru.
"

Mario Vargas Llosa kämpft mit eigenen Gespenstern und geht doppelt ins Exil / Von Jens Jessen
Dieses ungeheuer dickleibige und vergnügte, geradezu naiv vergnügt daherkommende Buch, dessen Titel den Autor als "Fisch im Wasser" annonciert, wird manchem Leser große Enttäuschung bereiten. Denn es ist in keiner Hinsicht, was es zu sein scheint. Es ist zunächst einmal gar nicht dick, sondern eher dünn, was seine Stoffgrundlage betrifft; es schildert nämlich nicht das Leben des berühmten peruanischen Schriftstellers, sondern nur zwei, freilich prominente Episoden daraus. Mario Vargas Llosa schildert seine Jugend und Studentenzeit bis zur Abreise nach Madrid 1958, mit der ein europäisches Exil von anderthalb Jahrzehnten begann, und er schildert seinen gescheiterten Wahlkampf um die peruanische Präsidentschaft von 1987 bis 1990, der ebenfalls mit seiner Abreise nach Spanien und einem neuerlichen Exil endete, das bis heute andauert und von ihm nur unterbrochen wurde, als er kürzlich seine sterbende Mutter in Lima besuchte.
"Der Fisch im Wasser" ist also nicht Vargas Llosas Autobiographie; und auch was es mit seinem Titel auf sich hat, ist nur schwer begreiflich. Denn es ist keineswegs das optimistische Buch, das er suggeriert; die Jugend, an die sich Vargas Llosa erinnert, ist hart, seine Kindheit bitter, die Präsidentschaftskampagne ein Fehlschlag und die politische Lehre, die sie erteilt, von einiger Hoffnungslosigkeit. Wo sollte das leichtflüssige Element gewesen sein, in dem sich der Autor wie ein Fisch bewegte? Was er schildert, sind zwei Strecken der Mühsal. Freilich, zwischen ihnen, beginnend mit der ersten Europareise und den ersten literarischen Erfolgen, könnte das Leben schön und leicht gewesen sein; und tatsächlich hellt es sich schon gegen Ende seiner Studentenzeit auf, da er dem Zugriff seines jähzornigen Vaters entrinnt, überhaupt der Ehehölle seiner Eltern, und sich in jenes Liebesabenteuer mit einer wesentlich älteren Verwandten stürzt, das durch seinen Roman "Tante Julia und der Kunstschreiber" unsterblich geworden ist.
Er erzählt die Geschichte der heimlichen Liaison und Eheschließung übrigens mit Humor, aber liebevoll und diskret; sie hat, im Genre der Erinnerung, nicht die ironischen Funken des Romans (höchstens selbstironische), aber ist auch nicht so weit von ihm entfernt, daß man diesen für eine Lüge halten möchte, wie es Tante Julia behauptet hat, als sie, längst geschieden, aus dem heimatlichen La Paz einen familiären Bannfluch über den Roman verhängte und sich daranmachte, ein eigenes Buch als Gegendarstellung zu verfassen. Nimmt man Roman und Erinnerungen Vargas Llosas zusammen, ist überhaupt nur schwer zu verstehen, was Tante Julia, die er als schön, elegant, witzig und souverän schildert, so gekränkt haben mag; es sei denn, sie wäre in Wahrheit viel konventioneller und konservativer, als Vargas Llosa in seiner erinnerten Verliebtheit unterstellt, und Witz und Souveränität eher Projektionen seiner eigenen Ideale.
So etwas gibt es. Ironiker neigen dazu, den Menschen ihres Herzens gleichfalls Ironie zu unterstellen, damit es ihnen leichter fällt, sich zu ihnen zu bekennen (und sie als gleichrangig anzuerkennen). Überhaupt sind die Deformationen der Wirklichkeit in der Fiktion, die ja mit der Erinnerung schon beginnt, das durchgängige Thema des Buches; übrigens auch jenes, das die beiden Lebensepisoden miteinander verbindet. In der ersten, seinen Jugenderinnerungen, führt der Autor die Motive und Stoffe in ihrem Rohzustand vor, die wir aus seinen berühmten Romanen schon kennen, die Kadettenanstalt Leoncio Prado ("Die Stadt und die Hunde"), das Kleinstadtbordell am Rande Piuras ("Das grüne Haus"), die Diktatur Odrías und ein verkommenes Lokal mit dem hochtrabenden Namen La Catedral ("Das Gespräch in der Kathedrale"), schließlich seine Erfahrungen als Nachrichtenredakteur des Rundfunksenders Radio Panamericana, in dem tatsächlich ein katastrophenseliger Kollege sein bizarres Unwesen trieb, dessen Meldungen Vargas Llosa zu entschärfen hatte ("Tante Julia und der Kunstschreiber").
Am Rande berichtet er auch von der mörderischen Konkurrenz der Rundfunksender im Peru der fünfziger Jahre, die sich nicht nur - wie Boulevardzeitungen - mit Schreckensmeldungen zu überbieten versuchten, sondern auch mit täglichen Hörspielfolgen, die den späteren Telenovelas des Fernsehens schon bedenklich nahe kamen. Leider erzählt er nichts von dem Vorbild jenes Pedro Camacho, dem die selbstverfaßten Hörspielserien durcheinandergerieten und schließlich zu einem wirren Strom seiner Autorenfieberträume zusammenflossen. Vargas Llosa verweigert hier manches und enttäuscht fast planvoll, weil er die Suggestion vermeidet, in der Erinnerung einen wahren Kern aus den Erfindungen seiner Romane herauslösen zu können. Die Erinnerung ist ihm nur ein anderes Genre der Fiktion. Er sagt es nicht ausdrücklich, doch macht er es in der Gestik des Erzählens deutlich, mit Vorgriffen, Geheimnistuereien und anderen dramaturgischen Tricks ("Ich konnte nicht wissen, daß ich den neuen Erzbischof von Lima unter spektakulären Bedingungen wiedersehen sollte").
Ihn beschäftigt in erster Linie etwas anderes bei der Konfrontation von Fiktion und Wirklichkeit: nämlich das Unverständnis der Leser für das, was sie als Lüge oder üble Nachrede, jedenfalls als dreiste Entstellung der erlebten Wirklichkeit auffassen. Nicht nur Tante Julia erregte sich; in der Kadettenanstalt wurden tausend Exemplare des Romans "Die Stadt und die Hunde" feierlich verbrannt. Es ist nämlich nicht nur das im schlichten Sinne Lügenhafte der Literatur, das provoziert, sondern überhaupt das Neu- und Anderserzählen einer Geschichte oder die Zusammensetzung von Dingen zu einer Geschichte, die als zusammengehörig nie zuvor gesehen wurden. Es ist, kurzum, die schöpferische Willkür der Literatur mit ihrer Propagierung des Möglichen und ihrer Denunziation des Bestehenden, die verärgert; und zumal solche Leser, die an der Affirmation des Bestehenden ein Interesse haben. Darum hat Vargas Llosa immer wieder, hier und in einem berühmt gewordenen Essay, gerade das Lügenhafte der Literatur als ihre eigentliche Qualität und humane Botschaft propagiert, als ein utopisches und letztlich subversives Element.
Das Bestechende einer solchen Poetik liegt darin, daß sie kein politisches Engagement der Literatur, keine Gesinnung oder Tendenz im engeren Sinne annehmen muß, um den Haß der Diktatoren oder auch nur bornierter bürgerlicher Öffentlichkeiten zu erklären. Es genügt, wie der berühmte Formalismusvorwurf der Stalinisten zeigt, schon die Verweigerung der Affirmation, die in der Verweigerung der "Widerspiegelung", das heißt aber nur: des herrschenden Diskurses besteht. Das ist die eine Seite im Verhältnis von Literatur und Wirklichkeit; hier siegt der Autor, und die Anwälte der Wirklichkeit ballen haßerfüllt die Faust. Es gibt aber noch eine andere Seite, in der das Verhältnis eine gespenstische Dialektik gewinnt, und diese Seite zeigt sich in der zweiten Episode des Buches, in der gescheiterten Präsidentschaftskampagne von 1987 bis 1990.
Denn diese Kampagne, die damals wegen der weltliterarischen Prominenz ihres Kandidaten die Medien beherrschte, ist nicht nur gescheitert, weil zu ihrem Ende plötzlich mit dem japanischen Ingenieur Alberto Fujimori ein Kandidat auftauchte, von dem niemand zuvor etwas wußte, der aber das Rassenvorurteil der Indios und Cholos gegenüber dem "weißen" Vargas Llosa zu seinen Gunsten (des "gelben" chinito) nutzen konnte. Die Kampagne scheiterte auch an sich selbst; das heißt an ihrem eigenen, zunächst sanften und verhüllten, dann allmählich eskalierenden Irrwitz, der in dem Zweckbündnis heterogener Parteien mit Vargas Llosas auch nur lose zusammenhängendem Movimiento Libertad angelegt war. Die verbündeten Politiker begannen nämlich als Kandidaten untereinander zu konkurrieren und Fernsehwerbefeldzüge zu unternehmen, die in ihrer Absurdität von Vargas Llosa selbst hätten erfunden sein können. "Ein Kandidat für den Senat ließ sich von den Klängen einer von einem Bariton gesungenen Operettenarie umschmeicheln; ein Kandidat für das Abgeordnetenhaus zeigte sich, um seine Liebe zum Volk zu demonstrieren, zwischen üppigen Hinterbacken von Mulattinnen, die zu Afro-Rhythmen tanzten; ein anderer weinte, von alten Menschen umringt, deren Los er mit bebender Stimme beklagte."
Es wirkt, als erhöbe sich hier die ganze von dem Autor in "Tante Julia und der Kunstschreiber" grausam karikierte Medienwelt und nähme Rache an ihrem Satiriker. Diese Rache wirkt um so diabolischer und konsequenter, als der Autor den Medienirrsinn auch in diesem Erinnerungsbuch wiederum so gut und giftig beschreiben kann, daß jeder einsieht, daß er sie verdient hat. So kommen die Dämonen über ihren Schöpfer; oder, genauer gesagt, die Wirklichkeit kommt über ihn in den Verzerrungen und Überspitzungen, die er ihnen zugefügt hat, und lehren ihn auf schreckliche Weise, daß er gar nicht übertrieben und gelogen hat, als er sie entstellte. Dies ist die grausame Pointe von Vargas Llosas Präsidentschaftskandidatur; und sie erschöpft sich nicht in den Werbeexzessen.
Die Kampagne in ihrer Gesamtheit, in ihrem historischen Verlauf zeigt eine Figur, die geradezu als strukturelles Leitmotiv seiner Romane bezeichnet werden kann: Es ist die Figur einer langsamen Entgleisung, eines Crescendos des Unheils. In dem "Hauptmann und das Frauenbataillon" hat Vargas Llosa diese Figur als Komödie, in "Maytas Geschichte" als Tragödie, in dem "Krieg am Ende der Welt" als historisches Muster Lateinamerikas gestaltet. Auch die Soldatenexpedition, die im "Grünen Haus" an der tropischen Hölle des Amazonas scheitert, hat Züge einer solchen ahnungslos-ahnungsvollen Präfiguration, ja selbst Pedro Camachos Hörspielkonfusion in ihrem Anschwellen des Wahns; doch keine der literarisch gestalteten Entgleisungen ähnelt so der Präsidentschaftskampagne wie die Geschichte des Hauptmanns, der ein Prostituiertenbataillon zur Versorgung der Truppe gründet: wegen der hemmungslosen Gutartigkeit des Hauptmanns, die ein wenig auch die des Politikers Vargas Llosa ist.
Es ist nicht so, daß er es nicht ahnte. Im Rückblick amüsiert er sich selbst über seinen idealistischen Verzicht auf alle politische Taktik und Verstellung. Ein andermal sagt er, er habe den Eindruck, den Stoff für einen Roman über political fiction zu erleben. Überhaupt beschäftigt ihn das Fiktionale in der Politik; zum einen, weil es der Schlüssel zur Demagogie seiner Gegner ist, die ihn überrumpelt; zum anderen aber, weil er einen höchst literarischen Vorgang, nämlich den Sieg der ideologischen Mythen über die Wirklichkeit, beobachtet. Diesmal aber siegen die Erfindungen nicht in der Literatur über die Wirklichkeit, sondern sie siegen in der Wirklichkeit, sie werden selber wirklich. Darin liegt die merkwürdige Entsprechung der beiden Teile dieses Buches; die Geschichte des Wahlkampfes und die Jugenderinnerungen spiegeln beide das Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit, aber sie tun es sozusagen einmal seitenverkehrt und einmal richtig herum. Darum konnte Vargas Llosa die beiden entfernten Lebensepisoden in einem Buch zusammentun, und mehr als das: sie kapitelweise ineinanderschachteln.
Dieses Verfahren, das zunächst verblüfft und als Verlegenheit wirkt, gewinnt an Überzeugungskraft in dem Maße, in dem sich die Teile gegenseitig zu belichten beginnen. In dem Wahlkampf des Schriftstellers beginnen die Gespenster seines Werkes zu leben. Was immer er in seinen Büchern diagnostizierte und als Bedrohung lateinamerikanischer Staaten und Gesellschaft vorführte, Demagogie der Herrschenden, Sprachlosigkeit zwischen den Schichten und Rassen, Magie und Aberglaube unter einer dünnen Decke der Vernunft: es nahm in seinem Wahlkampf Gestalt an. Wahrlich, es müßte Vargas Llosa schaudern, mit welcher Konsequenz seine Lieblingsbefürchtungen, die er in seine Bücher gebannt hatte, ihm nun in der Wirklichkeit entgegentraten, als sei der Bann von ihnen gewichen in dem Moment, da er von der Rolle des Künstlers zu der des Tatmenschen wechselte.
Doch liegen solche Dämonisierungen dem Autor fern; und schon gar solche allegorischer Art. Mario Vargas Llosa ist kein Metaphysiker; er ist ein positivistischer Skeptiker durch und durch. Er schildert die Entgleisung seiner Präsidentschaftskampagne nicht monokausal und schon gar nicht als literarisch präfiguriertes Verhängnis. Er läßt vieles zusammenwirken: den zunehmenden Terror der Guerrillas; die Unbildung und messianische Verführbarkeit der Massen; auch seine eigene Naivität als Intellektueller, der selbst als Politiker sich niemals verstellen will und gerade so die gefährlichsten Mißverständnisse erzeugt; schließlich die bedenkenlose Intrige der regierenden Partei (APRA), die im zweiten Wahlgang auf Fujimori setzt, nur um Vargas Llosa zu schaden. (Sie wurde dafür streng bestraft. Nachdem Fujimori seinen Wahlsieg in eine Diktatur verwandelt hatte, begann er sogleich, die Politiker der APRA zu verfolgen, gefangenzusetzen oder ins Exil zu treiben.)
Mario Vargas Llosas Erinnerungen sind ein merkwürdiges, langwieriges, nur streckenweise amüsantes Buch, das jedoch interessantesten Aufschluß für alle Kenner und Liebhaber seines Werkes verspricht und darüber hinaus noch einige höchst gespenstische Pointen über das Verhältnis von Literatur und Wirklichkeit, Politik und Kunst. Freilich bleibt das Gespenstische in seinem vollen Maß dem Autor unbewußt. Vargas Llosa, obwohl einer der größten und auch populärsten lateinamerikanischen Schriftsteller der Gegenwart, ist zugleich das Gegenteil von dem, was man sich gemeinhin unter einem solchen vorstellt. Vargas Llosa ist Voltairianer, kein Rousseauist. Das schützt ihn vor manchem.
Seine Ironie ist voltairianisch, und voltairianisch ist sein Kampf gegen Animismus und Aberglauben, in denen er niemals, und sei es zum Zwecke der Dichtung, einen überlegenen Naturzustand des Geistes sehen würde, wie es García Márquez gerne tut. Wenn er das magische Weltbild seiner Landsleute literarisch gestaltet, dann tut er das ohne jenes Einverständnis, das Carlos Fuentes, und sei es zum Zwecke der Allegorie, gelegentlich vorspiegelt. Nur ein einziges Mal, nämlich in dem vorliegenden Buch, bekennt er, nahe davor zu sein, an den Magischen Realismus zu glauben, aber das ist während seiner Wahlkampagne, als sich bizarre Vorfälle zu offenem Aberwitz steigern, und er sagt es mit ironischem Sarkasmus, mit spürbarer Verachtung für die bequeme Flucht aus der Analyse ins Weltbild.
In gewisser Hinsicht, in der voltairianischen Geschütztheit seiner Rationalität, ist Vargas Llosa ein glücklicher Mensch; und das teilt sich auch, über alle Bitterkeiten und Fehlschläge hinweg, in seinen Erinnerungen mit. Sie sind frei von Resignation und Misanthropie. Selbst sein spezifischer Pessimismus, der rational und innerweltlich ist, hat etwas von dem begrenzten Pessimismus des "Candide". Er erwartet keine Erlösung für den Menschen, keine religiöse im Jenseits und keine politische im Diesseits. Er ist aber auch frei von apokalyptischen Erwartungen und Erkenntniszweifeln. Insofern ist dieser Pessimismus einem skeptischen Optimismus verwandt, und tatsächlich liegt über Vargas Llosas Erinnerungen eine gelöste Serenität, eine selbstironische Lebenstüchtigkeit, die es am Ende doch gestatten, von einem Fisch im Wasser zu sprechen, einem ziemlich schillernden allerdings.
Mario Vargas Llosa: "Der Fisch im Wasser". Erinnerungen. Aus dem Spanischen übersetzt von Elke Wehr. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1995. 676 S., geb., 78,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main