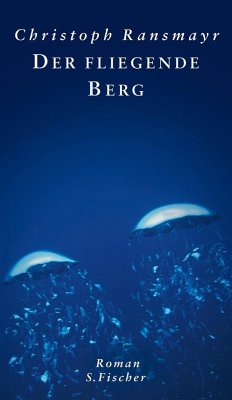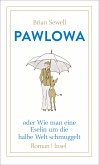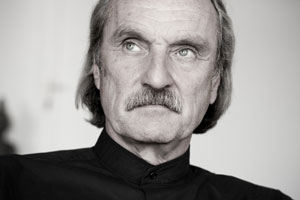'Der fliegende Berg' ist die Geschichte zweier Brüder, die von der Südwestküste Irlands in den Transhimalaya, nach dem Land Kham und in die Gebirge Osttibets aufbrechen, um dort, wider besseres (durch Satelliten und Computernavigation gestütztes) Wissen, einen noch unbestiegenen namenlosen Berg zu suchen, vielleicht den letzten Weißen Fleck der Weltkarte. Auf ihrer Suche begegnen die Brüder nicht nur der archaischen, mit chinesischen Besatzern und den Zwängen der Gegenwart im Krieg liegenden Welt der Nomaden, sondern auf sehr unterschiedliche Weise auch dem Tod. Nur einer der beiden kehrt aus den Bergen ans Meer und in ein Leben zurück, in dem er das Rätsel der Liebe als sein und seines verlorenen Bruders tatsächliches, lange verborgenes, niemals ganz zu vermessendes und niemals zu eroberndes Ziel zu begreifen beginnt. Verwandelt von der Erfahrung, ja der Entdeckung der Wirklichkeit, macht sich der Überlebende am Ende ein zweites Mal auf den Weg.

Wortgefechte: Die schöne Literatur in diesem Herbst
Neben den wichtigen Erinnerungsbüchern von Kertész, Fest und Grass müßte es der Roman schwer haben. Aber die Gegenwartsliteratur verlangt mit drastischen Mitteln nach Aufmerksamkeit. Ihr Thema ist der Terror.
"Im Alter von vierzehneinhalb Jahren", so erinnert sich der ungarische Nobelpreisträger Imre Kertész in seinem neuen Buch "Dossier K.", "stand ich etwa eine halbe Stunde lang Auge in Auge dem Lauf eines feuerbereiten Leichtmaschinengewehrs gegenüber, das auf mich gerichtet war." Das war im Sommer 1944 im Hof der Budapester Gendameriekaserne. Wenig später wurde Kertész nach Auschwitz deportiert.
Im Jahr darauf, im Frühjahr 1945, steht der siebzehnjährige Günter Grass mit der Maschinenpistole in der Hand einem russischen Schützenpanzer gegenüber: ",Der Iwan!', rief ich der Gruppe am Wegrand zu, nahm mir aber keine Zeit, die dem Feindpanzer dicht bei dicht aufsitzenden Schützen als einzelne zu erkennen und so zum ersten Mal einem lebenden Sowjetsoldaten von Gesicht zu Gesicht zu begegnen."
Zwei Nobelpreisträger, zwei Augenblicke mit und ohne Blickkontakt, zwei Erinnerungsbücher, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Zusammen mit Joachim Fests Autobiographie "Ich nicht" (Rowohlt) setzen "Dossier K." (Rowohlt) und "Beim Häuten der Zwiebel" (Steidl) einen gewichtigen Schwerpunkt in diesem Bücherherbst. Er gilt der Vergangenheit und ihren nicht enden wollenden Nachwirkungen, er erzählt von drei vollkommen unterschiedlichen Schicksalen und Lebenswegen im "Dritten Reich", und er konfrontiert den Leser dreimal auf jeweils ganz eigene Weise mit der Frage nach dem Wesen und den Grenzen des autobiographischen Genres.
Neben diesen Büchern, so könnte man meinen, dürfte es der Gegenwartsroman schwer haben. Aber die Gegenwart fordert ihr Recht auf Aufmerksamkeit mit nicht weniger drastischen Mitteln. Sechzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stehen Haß und Gewalt, Blutvergießen und Leid und Elend von Unschuldigen ebenso im Zentrum dieses Bücherherbstes wie die Erinnerungen einer Generation, die lange Zeit glauben durfte, all dies weitgehend hinter sich gelassen zu haben. Der Terror ist in veränderter Gestalt nach Europa zurückgekehrt, und viele Romane dieses Herbstes haben ihn zum Thema.
Yasmina Khadra, ein ehemaliger Offizier der algerischen Armee, hat soeben im Gespräch mit dieser Zeitung darauf aufmerksam gemacht, daß Europa den Terrorismus nicht als Importartikel betrachten dürfe (F.A.Z. vom 29. September). Die Quellen terroristischer Gewalt sprudeln in Europa nicht anders als in den Vereinigten Staaten oder in der islamischen Welt. In den letzten Jahren hat sich die Literatur vor allem der Opfer angenommen, jetzt ist ein Wechsel der Perspektive zu verzeichnen. Im vorigen Jahr hat der junge amerikanische Autor Jonathan Safran Foer ein New Yorker Wunderkind ins Zentrum seines Romans "Extrem laut und unglaublich nah" gestellt, das seinen Vater beim Anschlag auf das World Trade Center verloren hat. Yasmina Khadras Held ist ein arabischer Chirurg in Israel, der die Opfer eines Attentats operiert, das seine eigene Frau verübt hat. In immer neuen Anläufen kreist der Roman "Die Attentäterin" (Nagel & Kimche) um die Frage, was eine junge Frau aus geregelten Mittelstandsverhältnissen dazu bewogen haben mag, sich selbst in die Luft zu sprengen, um möglichst viele Menschen mit sich in den Tod zu reißen.
Während Khadra ein Bild der Attentäterin nur aus Erinnerungen und Erzählungen entstehen läßt und die Introspektion verweigert, läßt Christoph Peters uns in seinem neuen Roman "Ein Zimmer im Haus des Krieges" (btb) gleich in zwei Köpfe schauen. Sie gehören dem islamistischen Terroristen Jochen "Abdallah" Sawatzky und dem Botschafter der Bundesrepublik in Kairo, der den deutschen Staatsangehörigen Sawatzky vor der Hinrichtung in Ägypten bewahren soll. Der erste Teil des Romans schildert eindrucksvoll die letzten Stunden vor dem Anschlag in Luxor, der für die Terroristen mit einer Katastrophe endet: Sie werden von ägyptischen Sicherheitskräften erwartet, gejagt und zum größten Teil getötet. Sawatzky kommt mit dem Leben davon, ist aber den brutalen Verhörmethoden im ägyptischen Hochsicherheitsgefängnis ausgesetzt. Niemand kann wissen, was im Kopf eines Terroristen vorgeht, der den eigenen Tod vor Augen hat, aber Peters vermittelt uns zumindest eine Vorstellung davon, wie sie eindringlicher und beklemmender kaum sein könnte.
Gleich drei Seelen in eine Brust implantiert der indische Schriftsteller Kiran Nagarkar. Seine Hauptfigur namens Zia ist "Gottes kleiner Krieger" (A1 Verlag), von dem der Titel des Romans kündet. Zia, der als indischer Muslim geboren wird, wechselt zwar zweimal die Religion, nicht aber den Charakter. Auch als Trappistenmönch und als Hindu bleibt er ein Eiferer und gewaltbereiter Fanatiker. Bietet also jede Religion dem Extremisten Anknüpfungspunkte? Wird also derjenige zum religiös motivierten Terroristen, in dem die charakterliche Disposition dazu angelegt ist, gleichviel, welcher Religion er angehört? Nagarkars phantasievoller und erzählerisch überbordender Roman ist das wichtigste unter den erstaunlich zahlreichen interessanten und guten Büchern, die uns in diesem Herbst aus Indien erreichen. Das diesjährige Gastland der Frankfurter Buchmesse wird zweifellos Spuren hinterlassen.
Aber hat die Literatur denn sonst nichts mehr zu bieten außer den Erinnerungen der Greise und den Schrecken der Gegenwart? Ganz im Gegenteil, die Zahl guter Bücher ist in diesem Herbst erstaunlich groß, und in jedem Genre sind Entdeckungen zu machen, angefangen bei den Romandebüts eines Steffen Popp ("Ohrenberg oder der Weg dorthin"; kookbooks) oder Michel Mettler ("Die Spange"; Suhrkamp) bis hin zur Lyrik von Charles Simic ("Mein lautloses Gefolge"; Hanser) oder den abgründig funkelnden Kalendergeschichten und Prosaminiaturen, die Botho Strauß unter dem Titel "Mikado" (Hanser) versammelt hat.
Auffallend ist dabei nicht zuletzt, daß die Literatur in diesem Herbst viel formbewußter auftritt als in den Jahren zuvor: Neben die Lust am Erzählen tritt der Wille zur Form. Christoph Ransmayrs erster Roman seit elf Jahren ist ein Versepos, gehört also zu jenem selten gewordenen Genre, dessen sich zuletzt so gewichtige Autoren wie Derek Walcott mit "Omeros", Les Murray mit "Fredy Neptune" und Durs Grünbein mit "Vom Schnee" angenommen haben. Während Ransmayrs "Der fliegende Berg" (S.Fischer) eine Geschichte von Eifersucht und Bruderliebe im ewigen Eis von Tibet erzählt, nähert sich Felicitas Hoppe dem ewigen Feuer der Hölle und den gierigen Flammen der im Namen der Christenheit errichteten Scheiterhaufen. Auf einem dieser Scheiterhaufen endet Johanna, Jungfrau von Orléans und Titelfigur von Felicitas Hoppes neuem Buch (S. Fischer). Der Vielzahl der Deutungen der historischen Johanna wird hier nichts hinzugefügt, aber die Hoppesche Sprachkunst bewirkt, daß uns selbst eine Ikone wie Johanna entgegentritt, als begegneten wir ihr zum ersten Mal.
Der Tod, die Liebe, die Freuden und Nöte der Kindheit, das sind die ewiggleichen Themen der Literatur, und der Ire John Banville zeigt in "Die See" (Hanser), daß man sie immer wieder aufs neue behandeln kann. Tatsächlich ein Novum ist der neue Roman des Österreichers Wolf Haas. Oder wann hätte es zuvor einen Roman in Dialogform gegeben? "Das Wetter vor 15 Jahren" (Hoffmann & Campe) ist kein Briefroman und kein Drama, sondern die Wechselrede zweier Figuren über ein Buch, den Roman im Roman also. In dem mehrtägigen Gespräch zwischen einem Schriftsteller namens Wolf Haas und einer Literaturkritikerin, die als "Literaturbeilage" bezeichnet wird, erfährt der Leser nicht nur den überaus spannenden Inhalt des Romans, sondern wird überdies zum Zeugen einer Liebesgeschichte zwischen zwei literarischen Verbalerotikern. Das klingt kompliziert, konstruiert und so schrecklich ausgedacht, als wäre hier ein Albtraum wahr geworden, als habe nämlich ein Schriftsteller ein Buch einzig und allein für die Literaturkritik geschrieben. Aber das Gegenteil ist wahr. Haas hat sich einen Traum erfüllt, der unerfüllbar schien: Einmal etwas ganz anderes als alle anderen zu machen. Daß dieses Buch gelungen ist, grenzt an ein Wunder. Es zu lesen ist ein Vergnügen. Was für ein Bücherherbst!
HUBERT SPIEGEL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Tilman Spreckelsen hat schon lange kein Versepos mehr gelesen. Wieso auch. Nun ist er doch sehr überrascht, wie gut sich diese unzeitgemäße Form macht, wenn einer wie Christoph Ransmayr sich ihrer "klug" und "mutig" bedient. Schon Ransmayrs ebenfalls als Verszyklus verfasstes Debüt hatte Spreckelsen mächtig beeindruckt. Daran fühlt er sich erinnert, als er den unerwartet weiten Kosmos vom "Gang ins Eis", von Bruderliebe und erzählender Wiedererweckung betritt. Und er rekapituliert, was so ein Verepos ausmacht: Transzendenz, Leitmotivik, Metaphorik. Alles da, meint Spreckelsen, auch wenn der Autor das nicht wahrhaben will (siehe Vorwort). Einen weiteren Beweis sieht er im retardierenden Moment, das die "stupende Sprachgewalt" des Buches manchmal bändigt und Erleben und Schilderung trennt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH