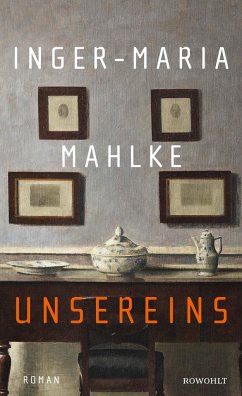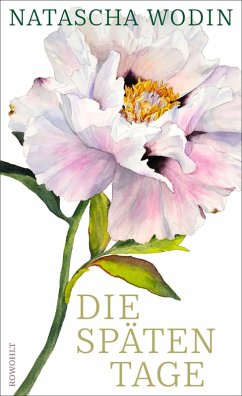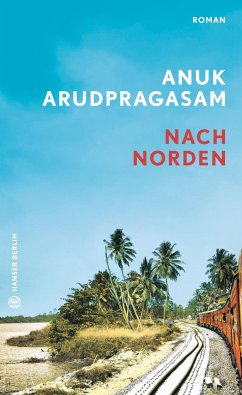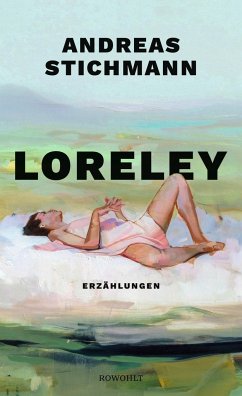Der Fluss und das Meer
Erzählungen Von der Autorin des Bestsellers "Sie kam aus Mariupol"
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
22,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nach den großen Romanerfolgen «Sie kam aus Mariupol» und «Nastjas Tränen» - Natascha Wodin erzählt in fünf Geschichten meisterhaft und mit großer Dringlichkeit vom Gefühl des Fremdseins im eigenen Leben und schenkt ihren Figuren eine Heimat in der Literatur.In der Titelgeschichte zieht die Erzählerin eine Spur von Mariupol am Asowschen Meer, an dem ihre Mutter aufwuchs, bis zur Regnitz in Franken, dem Fluss, in dem diese sich das Leben nahm. Zu einer anderen Zeit in ihrem Leben verliebt sie sich in einen Fremden, mit dem sie die Magie der Musik verbindet, oder sie beobachtet eine ve...
Nach den großen Romanerfolgen «Sie kam aus Mariupol» und «Nastjas Tränen» - Natascha Wodin erzählt in fünf Geschichten meisterhaft und mit großer Dringlichkeit vom Gefühl des Fremdseins im eigenen Leben und schenkt ihren Figuren eine Heimat in der Literatur.
In der Titelgeschichte zieht die Erzählerin eine Spur von Mariupol am Asowschen Meer, an dem ihre Mutter aufwuchs, bis zur Regnitz in Franken, dem Fluss, in dem diese sich das Leben nahm. Zu einer anderen Zeit in ihrem Leben verliebt sie sich in einen Fremden, mit dem sie die Magie der Musik verbindet, oder sie beobachtet eine verwahrloste Nachbarin, die ihre Umgebung wissentlich zugrunde gehen lässt. In Sri Lanka lernt sie Hunger und extremes Elend kennen, das die Welt sehenden Auges geschehen lässt, und in einer schweren existenziellen Krise zieht sie sich schließlich in eine Einsiedelei in den südpfälzischen Weinbergen zurück und ringt dort mit einer dunklen inneren Macht. Natascha Wodin führt uns auf die Nachtseite des Lebens und gibt den Außenseitern, den Einsamen und Verwundeten eine Stimme, die auch nach der Lektüre nicht verklingt.
«Natascha Wodins Bücher fragen, hinterfragen, suchen und entwickeln eine Erzählhaltung ganz eigener Art, deren Sog den Leser in den Glutkern politischer und menschlicher Abgründe führt.» Jury des Joseph-Breitbach-Preises
«Ihr Schreiben ist ein Joint Venture aus gewaltigem Schmerz und ungeheurer Kraft, von Verletzung, Lebenswillen, Angst und Wut und Dazugehörigkeitsverlangen.» Arnold Stadler
In der Titelgeschichte zieht die Erzählerin eine Spur von Mariupol am Asowschen Meer, an dem ihre Mutter aufwuchs, bis zur Regnitz in Franken, dem Fluss, in dem diese sich das Leben nahm. Zu einer anderen Zeit in ihrem Leben verliebt sie sich in einen Fremden, mit dem sie die Magie der Musik verbindet, oder sie beobachtet eine verwahrloste Nachbarin, die ihre Umgebung wissentlich zugrunde gehen lässt. In Sri Lanka lernt sie Hunger und extremes Elend kennen, das die Welt sehenden Auges geschehen lässt, und in einer schweren existenziellen Krise zieht sie sich schließlich in eine Einsiedelei in den südpfälzischen Weinbergen zurück und ringt dort mit einer dunklen inneren Macht. Natascha Wodin führt uns auf die Nachtseite des Lebens und gibt den Außenseitern, den Einsamen und Verwundeten eine Stimme, die auch nach der Lektüre nicht verklingt.
«Natascha Wodins Bücher fragen, hinterfragen, suchen und entwickeln eine Erzählhaltung ganz eigener Art, deren Sog den Leser in den Glutkern politischer und menschlicher Abgründe führt.» Jury des Joseph-Breitbach-Preises
«Ihr Schreiben ist ein Joint Venture aus gewaltigem Schmerz und ungeheurer Kraft, von Verletzung, Lebenswillen, Angst und Wut und Dazugehörigkeitsverlangen.» Arnold Stadler