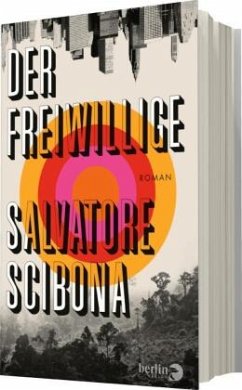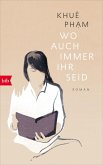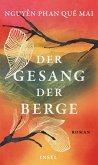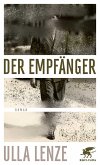Der Junge weint zum Steinerweichen. Er ist mit ein paar Dollar in der Tasche am Flughafen Hamburg ausgesetzt worden. Niemand versteht, was der verzweifelte Kleine sagt, also verstummt er, und dieser Roman muss seine Geschichte für ihn erzählen. Sie beginnt zwei Generationen vorher, als sich ein Mann aus einer Laune heraus freiwillig für den Vietnamkrieg meldet ...
Eine moderne Odyssee, die sich über ein halbes Jahrhundert erstreckt. Über den Krieg und seine Folgen im Frieden - emotional und klug lotet Scibona aus, wie wir unsere wahren Familien gleichermaßen erfinden und entdecken.
Eine moderne Odyssee, die sich über ein halbes Jahrhundert erstreckt. Über den Krieg und seine Folgen im Frieden - emotional und klug lotet Scibona aus, wie wir unsere wahren Familien gleichermaßen erfinden und entdecken.

Die Sünden der Väter setzen sich in den Söhnen fort: Im Roman "Der Freiwillige" erzählt der amerikanische Schriftsteller Salvatore Scibona von der Unvermeidlichkeit des Schuldigwerdens.
Die amerikanische Literatur wurzelt tief im Religiösen: seit Melvilles "Moby-Dick" mit seinen vielfältigen biblischen Anleihen und Anspielungen. Vor allem die großen sozialkritischen Romane, und seien sie auch von einem Agnostiker wie Upton Sinclair oder einem Desillusionierten wie John Dos Passos, führten diese Traditionslinie fort, und wer heute amerikanische Einzelgängerromane liest wie etwa die von David Vann, der wird sich vor lauter biblischer Thematik gar nicht retten können. Das setzt sich nun bei Salvatore Scibona fort. Auch er hat einen Einzelgängerroman geschrieben. Doch einen mit großem Personal.
Dieser Roman des 1975 geborenen Schriftstellers erschien im vergangenen Jahr in den Vereinigten Staaten, und die Übersetzungsrechte wurden weltweit verkauft. Der deutsche Verlag hat sich besonders beeilt, mehr als 550 Seiten von einer Prosa dieses Kalibers sind kein Pappenstiel. Mit Bettina Abarbanell und Nikolaus Hansen wurden gleich zwei versierte Übersetzer engagiert, um das erwünschte Tempo zu ermöglichen. Die Qualität stimmt aber auch, und das ist gerade wegen der stilistischen Registerwechsel des Erzählers auch nötig. Sie entsprechen den Perspektivwechseln des Romans.
Denn dessen Titel "Der Freiwillige" täuscht darüber hinweg, dass hier mehr als nur die Geschichte von Dwight Elliot Tilly erzählt wird, der unter anderem Namen geboren wurde und schon von seinen Eltern "Volunteer", also Freiwilliger, gerufen wurde - nach der Bezeichnung, die man im ländlichen Iowa für winterfeste Gemüsesamen verwendet. Als Überlebenskünstler sollte sich auch der junge Mann erweisen, der sich, sobald er 1968 volljährig wurde, zum Einsatz in Vietnam meldete und damit seinem Spitznamen gleich doppelt Ehre machte: Er ging freiwillig, und er überlebte.
Doch der Roman beginnt vier Jahrzehnte später in Hamburg, als ein kleiner Junge von seinem Vater auf der Durchreise im Flughafen zurückgelassen wird. Da niemand seinen Namen kennt, der amerikanische Dialekt, den das Kind spricht, aber an den Countrysänger Willie Nelson erinnert, bekommt der Knabe in dem kirchlichen Kinderheim, das ihn aufnimmt, den Rufnamen Willy. Dort nimmt sich ein Priester seiner an, aber keine Angst: Scibona hat keinen Missbrauchsroman geschrieben. Sondern ein Buch, in dem alle Männer - Frauen spielen hier mit einer Ausnahme keine größere Rolle - weniger an sich selbst zweifeln als am Schicksal, an der göttlichen Gnade. Ganz besonders der deutsche Priester.
Deshalb sucht er weltliche Hilfe in der Psychoanalyse, und sein Analytiker gibt ihm einen Leitspruch mit auf den Weg: "Hass kennt kein Ende, aber Liebe ist eine Sache von Tagen." Will heißen: Vergesst die Ewigkeit, lebt für die wenigen glücklichen Augenblicke. Die haben alle Akteure des Buchs bisweilen, aber der Hass ist stärker. Gar nicht einmal ein individueller, sondern die Feindschaft in größeren Zusammenhängen wie etwa im Vietnamkrieg, wo die unterschiedlichsten Typen zum Kollektiv der Marines zusammengeschmolzen werden, gemeinsam leben und gemeinsam töten. Und gemeinsam gefangengenommen werden, unglücklicherweise auf kambodschanischem Staatsgebiet zu einem Zeitpunkt, als beide Kriegsparteien der Welt versichert haben, dass sich jeweils keiner ihrer Soldaten im Nachbarstaat des Kriegsschauplatzes aufhält. Deshalb kann es für den Freiwilligen, als er als Einziger seiner Einheit wieder freikommt, keinen Wiedereintritt ins alte Dasein geben. Die amerikanische Regierung verschafft ihm eine neue Identität als Dwight Elliot Tilly, denn unter seinem alten Namen ist der Freiwillige längst offiziell für tot erklärt worden, weil er ja nicht in Kambodscha überleben durfte.
Der inoffiziell entsandte trouble shooter in dieser Angelegenheit heißt Percy Lorch und ist die faszinierendste Figur des ganzen Romans: eine mephistophelische Existenz, die dem von ihm zum neuen Namen und zum Abbruch aller alten Kontakte verurteilten Veteranen in unverbrüchlicher Treue verbunden bleibt und sich dabei betreffs seiner eigenen äußeren Umstände als noch wandelbarer erweist, als er es von seinem "Schützling" erwartet. Der verstößt einmal gegen das Kontaktverbot und sucht einen alten Kameraden auf, findet in der Einöde von New Mexico aber nur die letzten beiden Angehörigen einer kleinen Gruppe, die dort alternative Lebensweise und polygame Liebe erprobte, eine Frau und einen Jungen. Mit der Frau gründet Tilly eine Familie, in der der Junge an Kindes statt angenommen wird. Er wird später jener Vater sein, der seinen eigenen Sohn in Hamburg zurücklässt.
Bis es so weit kommt, springt die Handlung zwischen den Zeitebenen hin und her und genauso zwischen den Genres. Mit dem Kriegsroman in der ersten Hälfte gelingt Scibona die stärkste fiktionale Darstellung der psychologischen Belastungen des amerikanischen Einsatzes in Vietnam seit "Matterhorn" von Karl Marlantes. Nur lagen diesem 2009 erschienenen Roman die realen Erlebnisse seines Autors zugrunde, während Scibona erst geboren wurde, als die amerikanischen Soldaten schon abgezogen waren. Wie schlüssig er die Biographie des Freiwilligen auf dessen Kriegseinsatz hin erzählt und sie dann auch wieder herauslöst, das ist grandios. Und das ist auch die nur fünfseitige Schilderung eines Abends in Queens, die eine Stadtstimmung heraufzubeschwören versteht, wie man sie zuletzt in Don DeLillos "Underworld" gelesen hat.
Der zweite Teil des Romans, die Aussteigergeschichte, fällt dagegen ab. Zu sehr erinnert die Figurenzeichnung dort an Romane von T. C. Boyle, dessen großes Thema ja die Abgründe des alternativen amerikanischen Lebens sind. Aber was Scibona dann doch von Boyle unterscheidet, ist eben die religiöse Grundierung von "Der Freiwillige", die im biblischen Motiv des Opfers von Abraham ein Bild bereitstellt, das die sich von Generation auf Generation vererbende Vater-Sohn-Problematik leider zu plakativ begleitet. Die kleiner inszenierten Episoden um die Unvermeidlichkeit, Schuld auf sich zu laden, sind ungleich überzeugender geraten. Und am Ende wird das abrahamitische Opfer leider wenig überraschend ins Gegenteil verkehrt. Konsequenterweise trägt der Epilog den Titel "Jenseits". Ein Kapitel unter der Überschrift "Paradies" gab es schon vorher. Beides hat nichts miteinander zu tun.
Denn Vergebung wird hier niemandem gewährt, die Sünden der Väter holen die Söhne unvermeidlich ein. Unschuldig sind in diesem Roman nur die vielen Tiere, die immer wieder als Beobachter beobachtet werden. Mit ihnen identifizieren sich nicht nur manche Akteure, sondern auch erkennbar Salvatore Scibona selbst. Aber für Tiere ist die Lehre vom Himmelreich ja auch nicht gemacht. Mitten in der atmosphärisch so dichten Queens-Passage stellt der auktoriale Erzähler plötzlich die Frage: "Wie wird die Welt aussehen, wenn ihr böser Herrscher vertrieben ist?" Das Buch gibt keinen Anlass zur Hoffnung, dass es je so weit kommen könnte, solange die Menschheit lebt und tötet.
ANDREAS PLATTHAUS
Salvatore Scibona: "Der Freiwillige". Roman.
Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell und Nikolaus Hansen. Berlin Verlag, Berlin 2021. 558 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Andreas Platthaus lobt Salvatore Scibonas Buch als "Einzelgängerroman", dessen eigentlich zu junger Autor eine erstaunliche Menge über die Nachwehen des Vietnam-Krieges in den Köpfen ehemaliger GIs zu berichten weiß. Aufregend findet er auch die vielen Perspektivwechsel im Text, die es dem Autor ermöglichen, auf mannigfache Weise vom kollektiven Töten und von kollektiver Schuld erzählen zu lassen. Zeit- und Genresprünge und atmosphärisch dichte Schilderungen, etwa eines Abends in Queens, machen die erste Romanhälfte für Platthaus zum Ereignis. Der zweite Teil lässt dagegen nach, meint er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein ganz außergewöhnliches Buch« Radio freeFM "Freunde reden Tacheles" 20211008