Nicht lieferbar
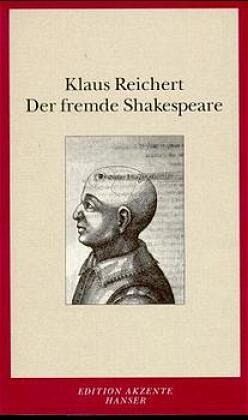
Der fremde Shakespeare
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Shakespeares Stücke sind in ihrer Rätselhaftigkeit bis heute eine Herausforderung. Klaus Reichert unternimmt es in den vorliegenden Studien und Aufsätzen, das dialektische Spiel von Ferne und Nähe - das, was er Shakespeares Fremdheit nennt - neu zu bestimmen.



