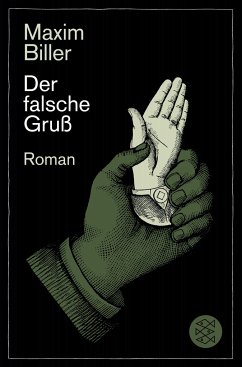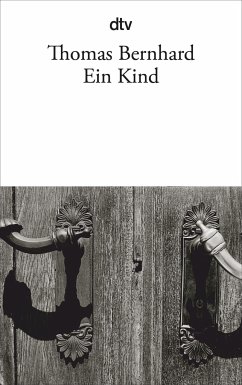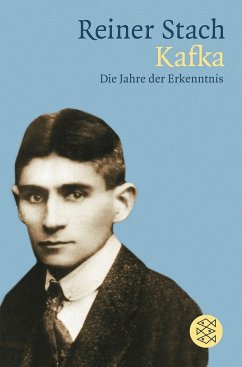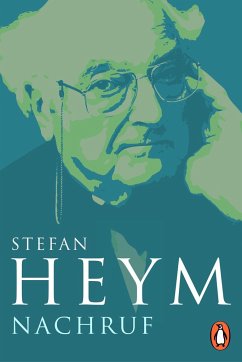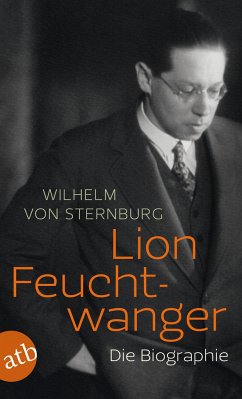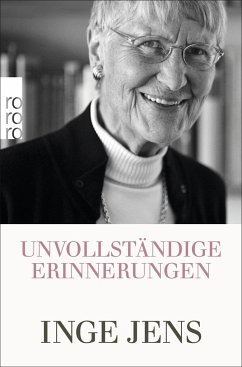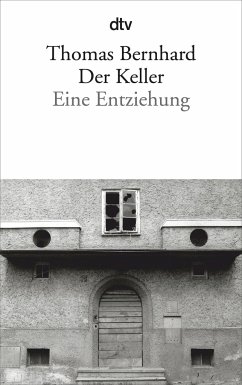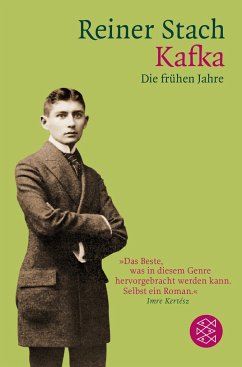Der gebrauchte Jude
Selbstporträt
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
15,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Geboren wurde er in Prag, mit zehn Jahren kam er nach Deutschland, mit siebzehn fing er an zu studieren - die Deutschen, ihre Bücher, ihre Frauen, ihre Fehler. Billers autobiographisches Buch erzählt wie ein Roman die tragikomische Geschichte eines Juden, der in einem Land Schriftsteller wird, in dem es keine Juden mehr hatte geben sollen. Leichthändig geschrieben, selbstironisch und spöttisch, ist dieses Buch weit mehr als das Selbstporträt eines Künstlers: es ist die immer neue Geschichte desjenigen, der seinen Platz in der Welt finden und sich selbst auf die Spur zu kommen versucht.