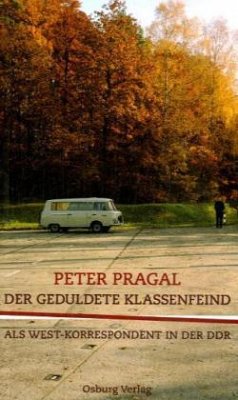Er verlegte als der Erste unter den akkreditierten westdeutschen Korrespondenten 1974 seinen Wohnsitz in die DDR-Hauptstadt und zog mit seiner Familie freiwillig von München nach Ost-Berlin, wo er von nun an unter den Augen und Ohren der Stasi arbeitete und lebte. Peter Pragal war kein Sympathisant des kommunistischen Systems, auch kein Abenteurer. Er war Journalist auf Entdeckungstour. Um das Leben der Menschen im sozialistischen deutschen Staat realistisch schildern zu können, passten sich die Pragals deren Alltag an. »"Pragal war bemüht, wie ein DDR-Bürger zu leben und zu denken", notierte die Stasi. So gelang es dem Autor, hinter die Fassaden der Diktatur zu schauen. Mit der Schärfe seines Blicks für die Unzulänglichkeiten des Arbeiter- und Bauernstaates wuchs sein Verständnis für die Menschen, die sich mit diesem System arrangieren mussten.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno