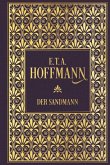Richard Obermayrs Debüt ist ein kühner, grandioser Wurf. Seine suggestive Kraft bezieht es gleichermaßen aus Idee und Ton, die es leiten, wie aus den Brennpunkten der Genauigkeit und der Überfülle poetischer Bilder. Dieser Roman ist ein lauter wie lächerlicher, ehrlicher wie leiser Protest, das Verschwinden nicht hinnehmen zu wollen. Ein leerstehendes, halb verfallenes Hotel an der Küste der Normandie ist der Ort, an den sich der Sohn geflüchtet hat, um noch einmal das Leben zu erschaffen. Er bevölkert die Zimmer mit Personen aus den Erinnerungen und schafft dafür anhand von Photographien, Briefen, Tagebuchaufzeichnungen, Plänen eine Kulisse. Die Ruine, der Geruch, die Gebrauchspuren der totemisierten Dinge sind jener Funke, an dem die eigene Geschichte sich entzündet. Lücken sind ihm Anlass, sie zu füllen, und er ist über alle Maßen dazu bereit. Was in diesem Schreiben mitschwingt, ist das weltliche Gegenstück zu dem aus der Religion vertrauten Bild vom Buch der Sünden, in dem alle Taten, die guten wie die schlechten, festgehalten sind. Viele Bilder fallen hier in einige wenige Felder: Schule, Bühne, Fest. Einen Schüler stelle man sich vor, der in seine Hefte schreibt, einen Schauspieler, der vor den Vorhang tritt, um seine große Rede zu halten.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Eine Fährte: Richard Obermayrs Roman "Der gefälschte Himmel"
Der Himmel muß in Romantiteln einiges erleiden. Veruntreut wurde er bei Franz Werfel, geteilt erschien er bei Christa Wolf, und nun führt uns der österreichische Debütant Richard Obermayr vor, wie man den Himmel fälscht. Echt und unkorrumpiert ist dabei des Autors Wille zum Grandiosen, sein Vorsatz, die Sprache vom Ballast des Alltäglichen zu befreien, sein Anspruch, als Dichter die Welt aus Worten neu zu erschaffen und unumschränkt über sie zu herrschen: "Ich war Herr der Erde, König des Meeres und des . . . Gartens, aus dem es keine Vertreibung gab." Die drei Punkte markieren keine Auslassung im Zitat, sondern sind ein Obermayrsches Markenzeichen, das den Text durchlöchert. Das kann so aussehen: "Ein warmer Wind fuhr wie Staunen ihr in die Lippen und rief einen Schrei in das . . . Leben" oder auch so: "Vor der Hütte . . . mein Vater bot mir den Pfefferminztee." Daß die Krone, die den Umschlag ziert, an eine fröhliche Kinderkritzelei erinnert, möge niemanden täuschen. Der junge Mann aus Ried im Innkreis meint es ernst, und er kennt kein Erbarmen, weder mit seinen Lesern noch mit sich selbst.
Wer je die Vorherrschaft des Trivialen in der zeitgenössischen Prosaproduktion beklagt hat, kann sich hier einer Roßkur unterziehen, die ihn am Ende reumütig nach einer linear erzählten Geschichte verlangen läßt und nach Sätzen, die zur Substanz des Mitgeteilten in einem ökonomischen Verhältnis stehen. Von solch bescheidenen Erwägungen ist das Literaturverständnis des Endzwanzigers Obermayr weit entfernt. In seinem Epos geht es zunächst um eine Art poetischer Ahnenforschung, im weiteren Sinne um die Evokation sämtlicher Erinnerungen, die das bisherige Leben des Dichterkönigs hergibt, und deren Einordnung in einen selbsterfundenen Kosmos, der den vorhandenen an Großartigkeit und Rätselhaftigkeit offenbar noch übertrumpfen soll. Die religiöse Dimension des Projekts wird bekräftigt durch theologische Anspielungen, durch das Andacht einfordernde Motto: "Mein Patron ist der ungläubige Thomas, der die Wunden des Herrn befühlt."
Der Großvater fiel in der Normandie, und der Enkel macht ein halbverfallenes Hotel an jener Küste zum Zentrum seiner Kommunikation mit den "Stimmen der Toten", zum Ausgangsort seiner Gedankenwanderungen in die nahe und ferne, die erlebte und die vorgestellte Vergangenheit. Briefe, Fotos, Tagebücher und andere Fundstücke dienen ihm als Auslöser für einen Monolog, der mit Pathos von Assoziation zu Assoziation springt und versucht, noch die banalsten Dinge und Vorgänge durch sprachschöpferische Gigantomanie zu adeln: "Ich las die Vorgeschichte des Tees, den wir am Morgen tranken. Man hatte sich der Tassen als Zeugen versichert. Damit die Hand meiner Mutter folgerichtig erscheint, weist sie sich mit dem schwarzen, schwenkbaren Griff des roten Kessels aus und auch mit dem Kesselstein, der sich auf dessen Boden gebildet hatte. Die Zuckerdose, sie entließ mich nicht. "
Anstrengung knirscht in allen Fugen dieses Wortgebäudes, dem vor lauter schiefen Bildern die Statik abhanden gekommen ist. Auf die priesterliche Emphase des schreibenden Weltherrschers, der auch als Wettermacher auftritt - "Ich begann zu schneien" -, reagiert der Leser mit grassierendem Unernst, obwohl es hier von Wasserleichen, Heldentoten, Katastrophenopfern, Beisetzungen und Grabstätten nur so wimmelt. Hat man erst einmal angefangen, in der apokalyptischen Metaphernflut nach erheiterndem Treibgut zu fischen, gibt es kein Halten mehr. Da geht ein Schiff auf Reisen, "umrast von der zärtlichen Folklore der Möwen, die als Wappenvögel in der Brust der Auswanderer schlugen". Beerdigungsgäste sitzen beisammen wie "Vögel, kaum noch federführend in der Kunst des Fliegens, und pickten den auf das Tischtuch gesäten Schweigsamen". Die Seele eines erlegten Hasen "umweht den spitzen Gipfel meines Bleistifts, auf ihn setze ich ein Kreuz".
Was man Richard Obermayr gewiß nicht vorwerfen kann, ist ein Mangel an Originalität und an Selbstbewußtsein. Wie eine hochmütige Zurechtweisung potentieller Kritiker klingt der Satz: "Es bellen die Windhunde, und wer wünschte nicht, eine Sprache zu beherrschen, die verwandt ist mit dem Schlagen der Flügel eines fliehenden Huhns." Der Autor, gefördert vom österreichischen Bundeskanzleramt, Sektion Kunst, kennt seine Qualitäten. Vielleicht wird er eines Tages, wenn sich ein Lektor mit Geflügelschere seiner annimmt, noch groß herauskommen. Eine zuverlässige Fangemeinde hat er schon jetzt: "Ich hörte das süße Seufzen der Rehe. Sie vergötterten mich. Ich hatte der Welt ein neues Kleid gegeben, ich durfte Dank erwarten." KRISTINA MAIDT-ZINKE
Richard Obermayr: "Der gefälschte Himmel". Roman. Residenz Verlag, Salzburg und Wien 1998. 365 S., geb., 47,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main