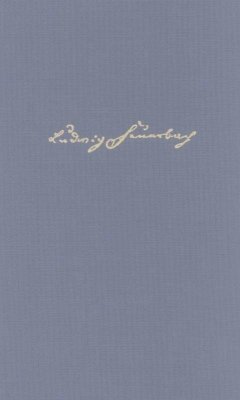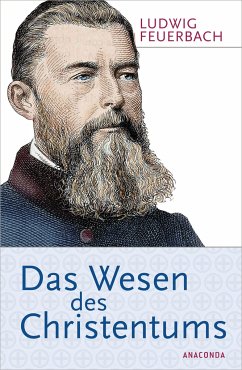Andreas U. Sommer
Gebundenes Buch
Der Geist der Historie und das Ende des Christentums
Zur "Waffengenossenschaft" von Friedrich Nietzsche und Franz Overbeck. Mit einem Anhang unpublizierter Texte aus Overbecks "Kirchenlexicon"
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!




Keine ausführliche Beschreibung für "Der Geist der Historie und das Ende des Christentums" verfügbar.
Andreas Urs Sommer, geb. 1972, Studium der Philosophie, Kirchen- und Dogmengeschichte und Deutschen Literaturwissenschaft in Basel, Göttingen und Freiburg im Breisgau, Lizentiat 1995, Promotion 1998 an der Universität Basel, 1998/99 Visiting Research Fellow an der Princeton University, 2000-2006 Wissenschaftlicher Assistent am Philosophischen Institut der Universität Greifswald, Visiting Fellow an der School for Advanced Study der University of London, Habilitation 2004 an der Universität Greifswald, Lehrstuhlvertretung an der Universität Mannheim, seit 2008 Wissenschaftlicher Kommentator der Werke Nietzsches an der Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, umhabilitiert an das Philosophische Seminar der Universität Freiburg
Produktdetails
- Verlag: Akademie Verlag
- 1997.
- Seitenzahl: 196
- Erscheinungstermin: 1. Dezember 1997
- Deutsch
- Abmessung: 246mm x 175mm x 17mm
- Gewicht: 444g
- ISBN-13: 9783050031125
- ISBN-10: 3050031123
- Artikelnr.: 25968664
Herstellerkennzeichnung
Walter de Gruyter
Genthiner Straße 13
10785 Berlin
productsafety@degruyterbrill.com
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für