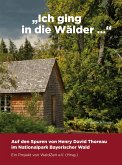Ein verblüffender Fund: Der junge Theodor Fontane entdeckt die viktorianische Erfolgsautorin Catherine Gore - Fontanes Übersetzung zeigt den werdenden Romancier.
Catherine Gore (1799-1861), eine der meistgelesenen Autorinnen ihrer Zeit, porträtierte in ihrem 1842 in Fortsetzungen
erschienenen Gesellschaftsroman Der Geldverleiher die englische Gesellschafts- und Finanzwelt. Mit drastischem Realismus und ihrer Beschreibungs- und Beobachtungskunst demaskiert sie eine Epoche voller Standesdünkel und antijüdischer Vorurteile. Theodor Fontane (1819-1898) hat den Roman der Zeitgenossin von der britischen Insel mit einer erstaunlichen Sprach- und Stilsicherheit übertragen - lange bevor er seine berühmten Romane schrieb, die ihn zum großen Klassiker des bürgerlichen Realismus machten.
Auf Grundlage eines wiederentdeckten Typoskripts hat der Literaturwissenschaftler, Historiker und Fontane-Biograph
Iwan-Michelangelo D'Aprile dieses übersetzerische Meisterstück aus Fontanes jungen Jahren ediert; sein Vorwort erhellt ein fehlendes Stück in Fontanes Gesamtwerk und bereichert uns um die Kenntnis seiner englischen Vorbilder.
"Ein richtiger Schmöker. Ein äußerst interessantes Buch des Übergangs von der romantischen Schauergeschichte zum
realistischen Roman ... Gore wollte unterhalten, und das ist ihr sehr gelungen." - Jürgen Kaube, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Catherine Gore (1799-1861), eine der meistgelesenen Autorinnen ihrer Zeit, porträtierte in ihrem 1842 in Fortsetzungen
erschienenen Gesellschaftsroman Der Geldverleiher die englische Gesellschafts- und Finanzwelt. Mit drastischem Realismus und ihrer Beschreibungs- und Beobachtungskunst demaskiert sie eine Epoche voller Standesdünkel und antijüdischer Vorurteile. Theodor Fontane (1819-1898) hat den Roman der Zeitgenossin von der britischen Insel mit einer erstaunlichen Sprach- und Stilsicherheit übertragen - lange bevor er seine berühmten Romane schrieb, die ihn zum großen Klassiker des bürgerlichen Realismus machten.
Auf Grundlage eines wiederentdeckten Typoskripts hat der Literaturwissenschaftler, Historiker und Fontane-Biograph
Iwan-Michelangelo D'Aprile dieses übersetzerische Meisterstück aus Fontanes jungen Jahren ediert; sein Vorwort erhellt ein fehlendes Stück in Fontanes Gesamtwerk und bereichert uns um die Kenntnis seiner englischen Vorbilder.
"Ein richtiger Schmöker. Ein äußerst interessantes Buch des Übergangs von der romantischen Schauergeschichte zum
realistischen Roman ... Gore wollte unterhalten, und das ist ihr sehr gelungen." - Jürgen Kaube, Frankfurter Allgemeine Zeitung