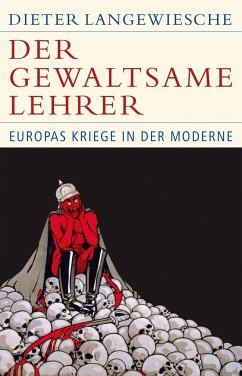Europas Kriege haben die Welt verändert. Kriege erzwangen seine Vorherrschaft in der Welt, Kriege beendeten sie. Kriege waren die Geburtshelfer von Nationen und Nationalstaaten, Kriege verhalfen Revolutionen zum Erfolg. Warum die Menschen immer wieder auf Krieg und Gewalt setzten, um ihre Ziele zu erreichen, davon handelt das Buch des renommierten Historikers Dieter Langewiesche.
Dass der Krieg eine historische Gestaltungskraft ersten Ranges ist, gehört zu den unbequemsten Wahrheiten der Geschichte. Und sie ist weiterhin aktuell. Nicht nur gibt es immer noch Kriege auf der Welt, selbst "humanitäre Interventionen" oder der Kampf gegen den Terror kommen ohne kriegerische Einsätze nicht aus. Warum aber greifen Menschen und Staaten überhaupt zum Mittel des Krieges? Wie haben Kriege Wandel ermöglicht oder verhindert? War der Krieg im europäischen Laboratorium der Staats- und Gesellschaftsordnungen sogar unverzichtbar? Der Tübinger Historiker Dieter Langewiesche beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit diesen Fragen und legt nun eine grundlegende Analyse vor, in der es nicht um Pulverdampf und Schlachtenlärm geht, sondern um den Ort des Krieges in der Geschichte der Moderne.
Dass der Krieg eine historische Gestaltungskraft ersten Ranges ist, gehört zu den unbequemsten Wahrheiten der Geschichte. Und sie ist weiterhin aktuell. Nicht nur gibt es immer noch Kriege auf der Welt, selbst "humanitäre Interventionen" oder der Kampf gegen den Terror kommen ohne kriegerische Einsätze nicht aus. Warum aber greifen Menschen und Staaten überhaupt zum Mittel des Krieges? Wie haben Kriege Wandel ermöglicht oder verhindert? War der Krieg im europäischen Laboratorium der Staats- und Gesellschaftsordnungen sogar unverzichtbar? Der Tübinger Historiker Dieter Langewiesche beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit diesen Fragen und legt nun eine grundlegende Analyse vor, in der es nicht um Pulverdampf und Schlachtenlärm geht, sondern um den Ort des Krieges in der Geschichte der Moderne.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Wolfgang Schneider bangt um den Frieden nach der Lektüre von Dieter Langewiesches Versuch, Gewalt und Kriege als Motor der Geschichte abzubilden. Diese "verdrängte" Wahrheit kann ihm der Historiker sachlich und ruhig ins Gedächtnis rufen. Globalhistorisch stellt er dabei die Idee des neuen asymmetrischen Krieges in Frage, so Schneider. Begriffe wie Nation, Revolution und Kolonialismus werden im Buch laut Rezensent ausführlich erörtert. Die Hoffnung des Autors, weitreichende Kooperationen mögen den Krieg weiterhin verhindern, teilt Schneider natürlich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Gewaltsam sind nicht nur seine Mittel, sondern auch seine Wirkung: Dieter Langewiesche erkundet die historische Gestaltungskraft des Krieges in der Moderne.
Im Januar 1793 machte Christoph Martin Wieland sich Gedanken über die außenpolitische Situation, die durch die Französische Revolution entstanden war: " Nur eine anhaltende Verwicklung der Nation in die Gefahren und Erfolge anhaltender Kriegsoperationen" werde den Republikanern "so viel Zeit und innere Sicherheit verschaffen, als sie zur Gewinnung einer festeren Konsistenz ihres noch so lockeren politischen Vereins nötig haben." Ähnlich sah man das jenseits des Rheins. Jacques Pierre Brissot, Wortführer der Girondisten, gab sich in einer später gern zitierten Äußerung überzeugt, "dass ein Volk, das nach zehn Jahrhunderten der Sklaverei die Freiheit errungen hat, Krieg führen muss. Es muss Krieg führen, um die Freiheit auf unerschütterliche Grundlagen zu stellen; es muss Krieg führen, um die Freiheit von den Lastern des Despotismus reinzuwaschen; und es muss schließlich Krieg führen, um aus seinem Schoß jene Männer zu entfernen, die die Freiheit verderben könnten."
Nicht viel anders dachten die Briten. Ihr Land solle "a warlike nation" sein, darin waren sie sich am siegreichen Ende des Siebenjährigen Krieges 1763 einig, und so hielt man es auch 150 Jahre später. Das Empire hatte immer irgendwo zu kämpfen, und so schrieb ein britischer Offizier stolz 1905: "Großbritannien ist nie im Frieden." Dass der Krieg eine historisch konstruktive Rolle spielen kann oder soll, das ist uns heute ganz fremd. Aber der Stolz auf kriegerische Gesinnung ist wie der Krieg selbst historisch fast der Normalfall. Dem nachzugehen, wie es der emeritierte Tübinger Historiker Dieter Langewiesche in seinem Buch tut, hat darin seine Berechtigung.
Langewiesche setzt mit dem achtzehnten Jahrhundert ein. Die stehenden Heere haben sich zu diesem Zeitpunkt schon herausgebildet. Deren Kosten bedeuteten eine völlig neue Inanspruchnahme öffentlicher Mittel, sie waren nur mit einer leistungsfähigen Steuerverwaltung aufzubringen. So trieb das Kriegswesen Institutionalisierung und Rationalisierung des modernen Staates entscheidend voran. Das hat den Autor weniger interessiert, wie auch die Bedeutung des Kriegswesens für die politische Verfassung. Teilnahme am Krieg bedeutet Teilhabe an der Macht; das ist ein wichtiger Grund, warum Frauen so spät erst das Wahlrecht erhalten.
Der Autor hat etwas anderes im Blick: die Staaten verändernde Rolle des Kriegswesens in Revolution, Nationalstaatsbildung und Kolonialpolitik. "Krieg als Gestaltungskraft", so lasse sich die Idee seines Buches charakterisieren; der Titel, der Geschichte des Peloponnesischen Krieges von Thukydides entnommen, spreche den "Gestaltungswillen" an und die Frage, in welchen Bereichen die Vorstellung "ohne Krieg kein Fortschritt" wirksam geworden sei.
Für die Revolution liegt der Fall klar. Sie kommt aus dem Willen, "Fortschrittsschranken" zu durchbrechen, dazu braucht es Gewalt. So ist es in der Englischen Revolution im siebzehnten Jahrhundert, auf die kurz zurückgeblickt wird, in der Amerikanischen, Französischen und natürlich in der Russischen Revolution. Die revolutionäre Sache bildet eine "Sondermoral" (Tocqueville) aus, deshalb denken Revolutionäre so oft bellizistisch, Engels und Lenin sind berühmte Beispiele. Der Krieg räumt die überständigen Verhältnisse ab und arbeitet als Schwungrad für die neue Sache. Deshalb auch wollten die deutschen Revolutionäre 1848 den Krieg gegen Dänemark um Schleswig und Holstein (Marx und Engels stimmten zu), und deshalb waren die Nachbarn aus Gründen der Revolutionseindämmung strikt dagegen. Zum Krieg kam es nicht, das hat der Revolution ungeheuer geschadet.
Und auch der Nationalstaat bildete sich nicht ohne Krieg heraus. Unter allen ideologischen Angeboten wirkte keines so verheißungsvoll wie das der Nation und ihres Staates. Der Nationalstaat verspricht seinen Bürgern faire Chancen auf Teilhabe, Langewiesche nennt es die "konkurrenzlose Attraktivität" der Nation als "Ressourcengemeinschaft". Der Krieg passt dazu, eben aus dem alten Grundsatz: Wer kämpft, ist frei, er darf mitbestimmen.
Dass die Kolonialpolitik sich des Krieges bedient, versteht sich von selbst. Bemerkenswert ist dabei aber, dass der Krieg wiederum im Dienste eines Ideals steht: "Uplifting mankind", wie es Theodore Roosevelt ausdruckt. Aber auch feinere Geister wie John St. Mill oder Tocqueville dachten so. Der Wiener Kongress 1814/15 hatte Europa ein Jahrhundert relativen Friedens beschert, Kriege waren hier kurz gewesen und eingehegt: Duellsituationen der Heere. Damit hatten sich die europäischen Mächte freie Hand in Übersee verschafft. Die Kriege dort bedeuteten entsetzliche Verluste für die indigene Bevölkerung. Bekannt ist die Strafaktion deutscher Truppen gegen die Herero, als diese 1904 in die Omaheke-Wüste getrieben wurden, wo sie elend umkamen. War es Völkermord? Unser Autor ist vorsichtig, er spricht von einem "genozidalen Zug" aus einer "dramatischen Überforderung" in einem Moment der Schwäche. Ein Sonderfall war es jedenfalls nicht. Die deutsche Politik stieß bei den europäischen Konkurrenten weniger auf moralische Empörung als auf Erstaunen über den Mangel an Professionalität.
Haben die Kolonialkriege die Verbrechen des zwanzigsten Jahrhunderts vorbereitet? Langewiesche hält sich auch hier mit seinem Urteil zurück. Aber er zitiert Tocqueville, der die Kolonialherrschaft bejahte und die damit verbundenen Kriege und dem doch davor graute: "Gott bewahre uns davor, jemals erleben zu müssen, dass Frankreich von einem Offizier der Afrika-Armee gelenkt wird." Langewiesche gibt aber auch zu bedenken, dass das Übermaß europäischer Gewalt nicht allein aus dem Rassismus zu erklären sei. Die indigenen Gesellschaften, auf die die Kolonialmächte trafen, waren oft höchst kriegerisch. Wo in Europa die Schlacht als Duell professioneller Soldaten gesehen und ihr Ausgang politisch anerkannt wurde, neigten viele Stämme dazu, den Kampf weiterzuführen, irregulär nach europäischem Verständnis.
Langewiesches Buch ist ein merkwürdiger Fall. Es stellt viel Material zusammen, das wenig bekannt ist und zu denken gibt. Aber die Linie, die sein Titel verspricht, ist ein Problem. Als Thukydides den Krieg einen "gewaltsamen Lehrer" nannte, in der sogenannten Pathologie (III, 82), hatte das eine klare Bedeutung: Gewaltsam ist dieser Lehrer nicht nur in seinen Mitteln, sondern in seiner Wirkung. Er zerstört die alten Vorstellungen von Klugheit und Rechtlichkeit und setzt neue durch, solche der Gewalt, Rücksichtslosigkeit und Unbedachtheit. Der Krieg lenkt die menschlich-moralische Entwicklung, aber er lenkt sie zum Bösen.
So klar ist Langewiesches Bild nicht, kann es allerdings auch nicht sein. Es ist nicht so klar im moralischen Urteil und auch nicht in der Frage, wo und inwieweit der Krieg Treiber der Entwicklung ist (wie bei Thukydides) oder Folge. Das hat mit der Komplexität von Gegenstand und Zeitraum zu tun, doch auch mit des Autors Neigung zu größeren Ab- und Ausschweifungen, beispielsweise zu den Vorzügen des Nationalstaats und den Gründen seiner Durchsetzung. Dergleichen kann den Leser gelegentlich ungeduldig stimmen, aber dann findet er wieder etwas Interessantes. Ohne den Nutzen produktiver Verwirrung wird er dieses Buch nicht lesen.
STEPHAN SPEICHER
Dieter Langewiesche:
"Der gewaltsame Lehrer". Europas Kriege in der Moderne.
C. H. Beck Verlag,
München 2019.
512 S., Abb., geb., 32,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Eine beeindruckende Synthese seiner langjährigen Arbeit zu den Themen Nation und Nationalstaat."
Historische Zeitschrift, Karen Hagemann
"Bis 1945 bedeutete die Gründung und Absicherung eines Nationalstaates stets, Krieg als politisches Mittel zu bejahen und einzusetzen. Warum dies so war, ja sein musste, was dieser Zusammenhang sowie der Krieg insgesamt bewirkten und warum sich dies nach dem Zweiten Weltkrieg derart radikal änderte, all dies wird in diesem brillanten Buch mittels der stringenten Gedankenführung und schnörkellosen Sprache seines Autors beeindruckend dargestellt."
Militärgeschichtliche Zeitschrift, Martin Moll
"In globaler Perspektive beschreibt der Autor souverän auch den Funktionswandel von Kriegen - ohne die Hoffnung aufzugeben, die Welt könne einmal ohne sie bestehen."
Damals - Das historische Buch des Jahres 2019 - Platz 1 Kategorie Denkanstöße
"So souverän, wie hier durch kluge Argumentation eine Metaebene gegenüber dem verbissenen Streit der wissenschaftlichen und politischen Kontrahenten gewonnen wird, ist auch der Umgang mit der gesamten Stoffmasse, die Langewiesche in seinem opus magnum bewältigt."
sehepunkte, Frank Becker
"Eine umfassende Analyse."
Neue Zürcher Zeitung, Thomas Speckmann
"Ein extrem lesenswertes und zum Weiterdenken anregendes Buch."
Cicero Online, Florian Keisinger
"Eine differenzierte Analyse europäischer Kriege, ihrer Typen und Entwicklungen seit dem 18. Jahrhundert."
Tagesspiegel, Tilmann Asmus Fischer
"Augenöffnend!"
Deutschlandfunk Kultur, Wolfgang Schneider
Historische Zeitschrift, Karen Hagemann
"Bis 1945 bedeutete die Gründung und Absicherung eines Nationalstaates stets, Krieg als politisches Mittel zu bejahen und einzusetzen. Warum dies so war, ja sein musste, was dieser Zusammenhang sowie der Krieg insgesamt bewirkten und warum sich dies nach dem Zweiten Weltkrieg derart radikal änderte, all dies wird in diesem brillanten Buch mittels der stringenten Gedankenführung und schnörkellosen Sprache seines Autors beeindruckend dargestellt."
Militärgeschichtliche Zeitschrift, Martin Moll
"In globaler Perspektive beschreibt der Autor souverän auch den Funktionswandel von Kriegen - ohne die Hoffnung aufzugeben, die Welt könne einmal ohne sie bestehen."
Damals - Das historische Buch des Jahres 2019 - Platz 1 Kategorie Denkanstöße
"So souverän, wie hier durch kluge Argumentation eine Metaebene gegenüber dem verbissenen Streit der wissenschaftlichen und politischen Kontrahenten gewonnen wird, ist auch der Umgang mit der gesamten Stoffmasse, die Langewiesche in seinem opus magnum bewältigt."
sehepunkte, Frank Becker
"Eine umfassende Analyse."
Neue Zürcher Zeitung, Thomas Speckmann
"Ein extrem lesenswertes und zum Weiterdenken anregendes Buch."
Cicero Online, Florian Keisinger
"Eine differenzierte Analyse europäischer Kriege, ihrer Typen und Entwicklungen seit dem 18. Jahrhundert."
Tagesspiegel, Tilmann Asmus Fischer
"Augenöffnend!"
Deutschlandfunk Kultur, Wolfgang Schneider