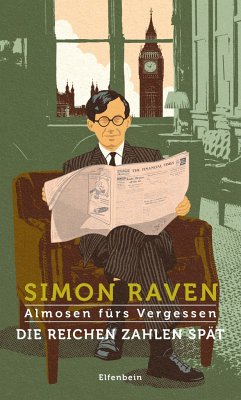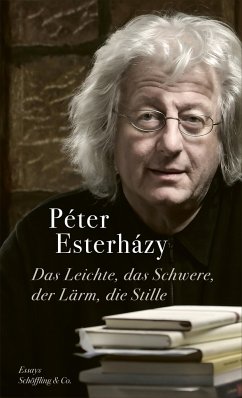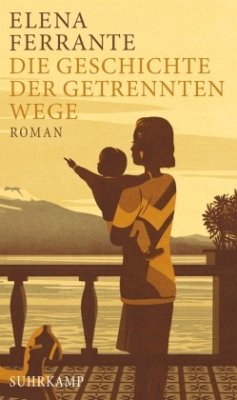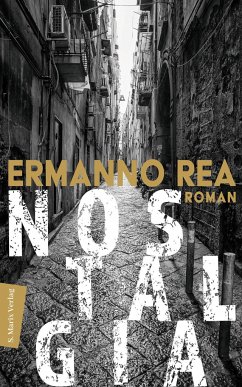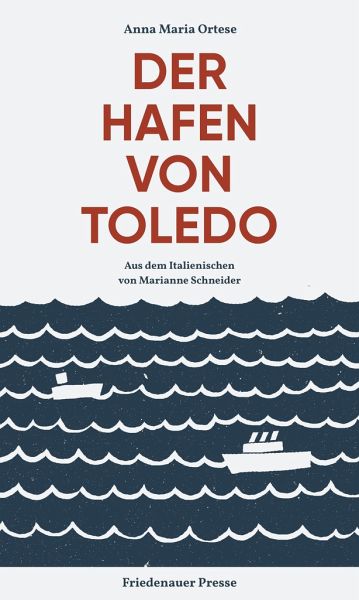
Der Hafen von Toledo
Roman
Mitarbeit: Gianotti, Tiziano;Übersetzung: Schneider, Marianne

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die dreizehnjährige Damasa und ihre Geschwister leben in einem heruntergekommenen Haus im düsteren Hafenviertel von Toledo. Ihre vermeintliche Teilnahmslosigkeit verschleiert die glühende und rebellische Natur des Mädchens, das mit zehn Jahren den Schulunterricht ablehnt, sich von der Kirche abwendet und nach dem tragischen Tod seines Bruders auf See Rettung in der Literatur findet. Die dunklen Schriften Damasas, in denen sie versucht, die flüchtigen Visionen ihres Geistes festzuhalten, ziehen uns in eine fesselnde Welt des Unsichtbaren und der Träume, eine »zweite, unwirkliche Realitä...
Die dreizehnjährige Damasa und ihre Geschwister leben in einem heruntergekommenen Haus im düsteren Hafenviertel von Toledo. Ihre vermeintliche Teilnahmslosigkeit verschleiert die glühende und rebellische Natur des Mädchens, das mit zehn Jahren den Schulunterricht ablehnt, sich von der Kirche abwendet und nach dem tragischen Tod seines Bruders auf See Rettung in der Literatur findet. Die dunklen Schriften Damasas, in denen sie versucht, die flüchtigen Visionen ihres Geistes festzuhalten, ziehen uns in eine fesselnde Welt des Unsichtbaren und der Träume, eine »zweite, unwirkliche Realität«. Aus dem Geheimnis dieser wundersam lyrischen Seiten entspringt ein Alltag voller Armut und Entbehrungen, während sich am Himmel das Schreckensgespenst des Krieges abzeichnet.
In Der Hafen von Toledo webt Anna Maria Ortese eine eindringlich dichte, traumwandlerische Atmosphäre, die den Roman zu einem unvergesslichen Leseerlebnis macht. 1975 erstmals veröffentlicht, ist das rätselhafte und von einer geheimnisvollen Schönheit erfüllte Buch heute ein Klassiker der modernen Literatur - ein Meisterwerk, das es auch hierzulande unbedingt zu entdecken gilt.
In Der Hafen von Toledo webt Anna Maria Ortese eine eindringlich dichte, traumwandlerische Atmosphäre, die den Roman zu einem unvergesslichen Leseerlebnis macht. 1975 erstmals veröffentlicht, ist das rätselhafte und von einer geheimnisvollen Schönheit erfüllte Buch heute ein Klassiker der modernen Literatur - ein Meisterwerk, das es auch hierzulande unbedingt zu entdecken gilt.